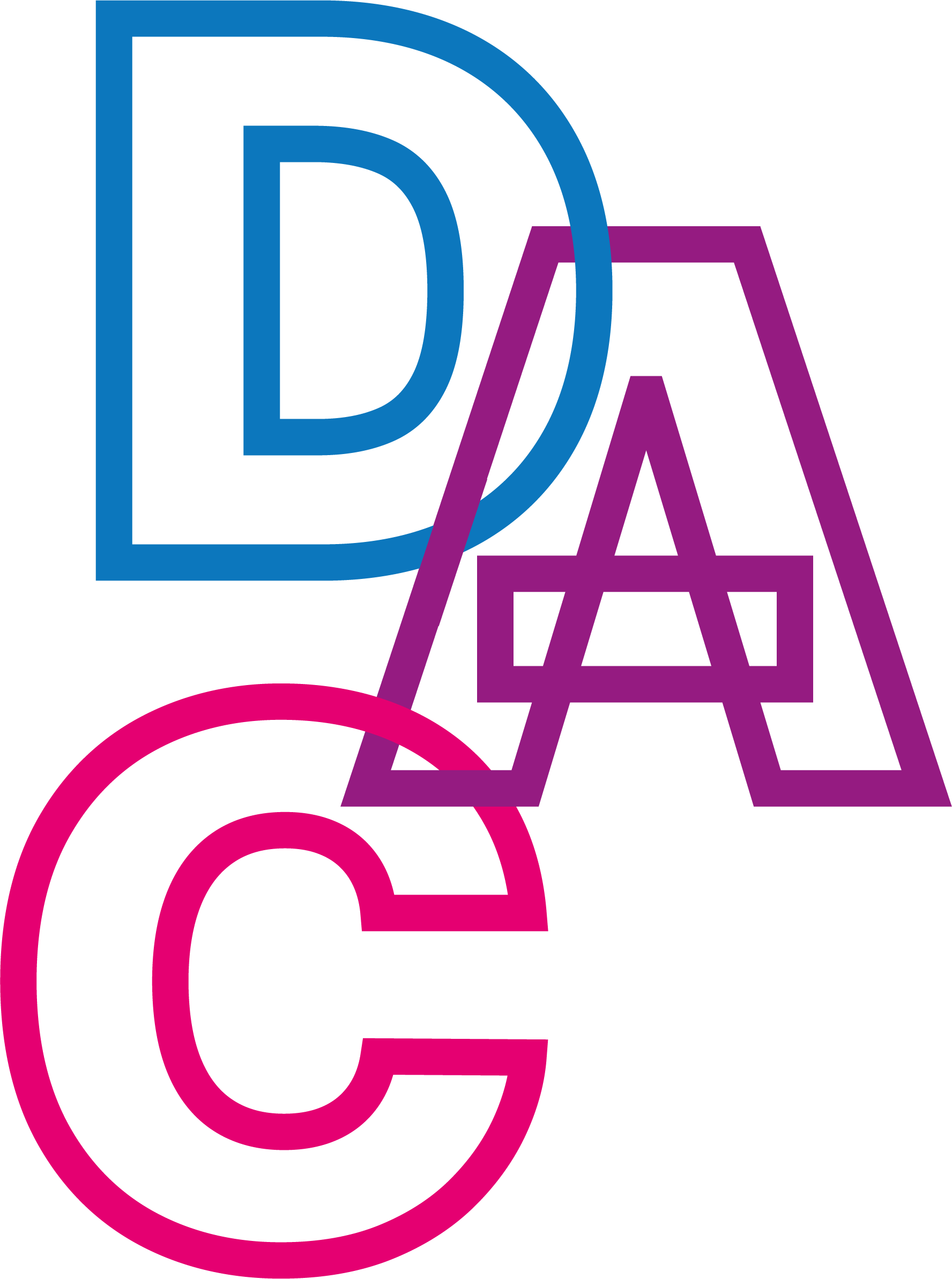Barrierefreie Kulturinstitutionen
12 Empfehlungen für die Praxis
Text: Carolin Huth und Dirk Sorge
1. Eigene Haltung und Privilegien reflektieren
Das Wichtigste zu Beginn: Wir müssen verstehen, wie Barrieren funktionieren und wie durch unsere Haltungen, Routinen und Konventionen Ausschlüsse wiederholt werden. Wenn wir unsere Haltung reflektieren und unsere Privilegien sinnvoll nutzen, kann das eine Grundlage sein, Barrieren abzubauen. Ausschlüsse beginnen nicht erst mit den Treppenstufen am Eingang der Kulturinstitution, sondern bereits an dem Punkt, wo ein Programm ohne eine behinderte Perspektive geplant oder selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass behinderte Menschen keine Relevanz für ein Programm oder eine Organisation haben. Wichtiges Wissen kann dann nicht berücksichtigt werden und die Folge sind schlechte Lösungen, die ihren Zweck nicht erfüllen.
Um dem zu begegnen, benötigen Sie Wissen. Beschäftigen Sie sich daher mit Ableismus und der Lebensrealität von behinderten Menschen. Setzen Sie sich mit dem sozialen und menschenrechtlichen Modell von Behinderung auseinander, mit Ihrer Sprachverwendung und Ihrer eigenen Arbeitskultur. Offenheit und die Bereitschaft, etwas über Diversität, Behinderung, Barrierefreiheit und Ableismus zu lernen, aber auch das Hinterfragen eigener Vorurteile und scheinbar selbstverständliche Positionen können ein erster Schritt sein, Barrieren abzubauen. Aber ganz wichtig: Wenn Ihre Haltung keine Konsequenzen für die Praxis hat, ist damit nichts gewonnen. Der Vorsatz „Wir möchten niemanden diskriminieren“ nützt marginalisierten Gruppen nichts, wenn er sich nicht auf konkrete Handlungen und Entscheidungen auswirkt.
Weiterführende Links:
- Wörterbucheintrag: Ableismus
- Wörterbucheintrag: Audismus
- Wörterbucheintrag: behindert werden
- Theresa Degener im Online-Handbuch „Inklusion als Menschenrecht“: Die UN-Behindertenrechtskonvention als Inklusionsmotor
- Rebecca Mascos im Online Magazin „Die Neue Norm“: Warum Ableismus Nichtbehinderten hilft, sich normal zu fühlen
- Universität zu Köln (Hrsg.): Das menschenrechtliche Modell
- Podcast von „Die Neue Norm“ mit Folgen an der Schnittstelle von Behinderung, Politik und Kultur
2. Soziales Modell von Behinderung und Ableismus verstehen
Ableismus und das soziale Modell von Behinderung stellen eine gute erste Grundlage dar, um sich mit dem Thema Behinderung inhaltlich auseinanderzusetzen. So lässt sich ein Verständnis zu Behinderung und Barrierefreiheit erwerben, das über Checklisten hinausgeht.
Das soziale Modell wurde von behinderten Wissenschaftler*innen entwickelt und verdeutlicht in Abgrenzung zum medizinischen Modell die politische und gesellschaftliche Verantwortung, Barrieren abzubauen und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Das soziale Modell beschreibt, wie Menschen durch die Art und Weise, wie gesellschaftliches Leben organisiert ist, behindert werden. Anders als beim medizinischen Modell, bei dem Behinderung als individuelles Schicksal oder Krankheit verstanden wird, markiert das soziale Modell strukturelle Benachteiligung und Ausgrenzung.
Der Begriff Ableismus ist vom Englischen abgeleitet und knüpft an das soziale Modell an. Wie auch bei anderen Ismen, geht es darum, gesellschaftliche Machtverhältnisse zu legitimieren. Unter Ableismus werden sowohl behindertenfeindliche Einstellungen und Praktiken gefasst als auch strukturelle Diskriminierung. Gesellschaftliche Normvorstellungen stellen die Grundlage dar, auf deren Basis Menschen mit vermeintlichen Defiziten auf ihre Behinderung reduziert werden. Ableismus ist ein Diskurs, der behinderte Menschen an einer nicht behinderten fiktiven Norm misst und dadurch als unterlegen markiert. Fehlende Teilhabe, Stigmatisierung und Diskriminierung sind die Folge von Ableismus.1
Es lohnt sich zu hinterfragen, wo im Kulturbetrieb und in der künstlerischen Produktion Ableismus wirkmächtig ist.
Weiterführende Links:
- Wörterbucheintrag: Soziales Modell von Behinderung
- Wörterbucheintrag: Ableismus
- Rebecca Maskos für die Bundeszentrale für politische Bildung: Ableismus und Behindertenfeindlichkeit. Diskriminierung und Abwertung behinderter Menschen
- Online-Magazin „Die Neue Norm“ – Das Magazin für Vielfalt, Gleichberechtigung und Disability Mainstreaming
3. Disability Mainstreaming berücksichtigen
„Jedwedes politisches und gesellschaftliches Handeln soll danach befragt werden, in welcher Weise es zur Gleichstellung und Teilhabe behinderter Menschen beiträgt oder sie verhindert.“ Mit diesem Zitat von Hermann Haack, dem früheren Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, sollen die Belange von behinderten Menschen vom Rand in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden. Das Ziel, dass die Herstellung von Barrierefreiheit eine selbstverständliche Aufgabe für die Gesellschaft sein sollte, wird auch Disability Mainstreaming genannt.
Für Maßnahmen, die Barrierefreiheit umsetzen, bedeutet dies, kritisch zu fragen, wem die Maßnahmen nützen und welche Wirkung sie tatsächlich entfalten. Disability Mainstreaming sucht vor allem nach Ansätzen, die nicht auf Sonderlösungen zurückgreifen, sondern innerhalb bestehender Prozesse und Systeme wirkliche Teilhabe schaffen. Der Gang durch die Hintertür, der den einzigen barrierefreien Zugang gewährt, oder separate Sitzplätze mit schlechter Sicht sind nur wenige Beispiele, wie schlechte Lösungen behinderte Menschen ausgrenzen und so das Gegenteil von Inklusion bewirken.
Weiterführende Links:
- Katrin Grüber: „Disability Mainstreaming“ als Gesellschaftskonzept
- Christine Braunert-Rümenapf, Büro des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung Berlin: Disability Mainstreaming – eine Strategie der Veränderung für zivilgesellschaftliche Organisationen
4. Ästhetische Normen und Narrative hinterfragen
Zu einer diskriminierungskritischen Haltung gehört auch, ästhetische Normen zu hinterfragen. Was verstehen wir unter künstlerischer Qualität? Welche Schönheitsideale, Körpernormen und Fähigkeiten erwarten wir von Personen auf der Bühne und auf welchen Kanon beziehen wir uns in unserem Kunstverständnis? Immer noch werden Werke, die sich künstlerisch mit Behinderung oder anderen Marginalisierungserfahrungen auseinandersetzen, mit dem Verweis abgelehnt, sie seien nicht relevant für die Allgemeinheit und nicht von öffentlichem Interesse. Dabei kann uns gerade die Frage danach, was nicht gezeigt wird und wo es Leerstellen in unserem Kunstverständnis gibt, neue Perspektiven und künstlerische Ästhetiken eröffnen.
Diese Fragen sind vor allem wichtig, wenn wir auf behinderte Kulturakteur*innen blicken, die auf Augenhöhe partizipieren wollen. Behinderte Menschen können erst seit kurzem und nur gegen große Widerstände den ersten Bildungsweg beschreiten und haben nur in den seltensten Fällen Kunsthochschulen besucht. Welche Maßstäbe werden dann beim Lesen künstlerischer Lebensläufe angelegt? Werden beispielsweise alternative Zugänge zum Kulturbetrieb ermöglicht und ist die Anerkennung von vergleichbarer Leistung und/oder autodidaktisch erworbenem Wissen möglich?
Weiterführende Links:
- Georg Kasch: „Sieh uns jetzt an“. Ableistische Narrative in Literatur, Film und auf der Bühne
- Das Disability Visibility Project – eine Online-Community, die sich der Erstellung, Weitergabe und Verbreitung von Medien und Kultur zum Thema Behinderung widmet; in englischer Sprache
5. Ableistische Stereotype und Cripping Up vermeiden
Auch im Programmbereich stellt sich die Frage, wie mit dem Thema Behinderung inhaltlich umgegangen wird. Ist es überhaupt ein Thema, das künstlerisch aufgegriffen wird, oder dient es nur als stilistisches Mittel oder Effekt? Nicht selten verstärken Erzählungen über Behinderung ableistische Stereotype und Narrative, die gesellschaftlich tief verankert sind. Der Ausgestoßene, der Böse, der Freak, der Bemitleidenswerte oder der Infantile sind nur einige Beispiele von Figuren, die, mit einer Behinderung ausgestattet, eine bestimmte Funktion erfüllen sollen. Damit ableistische Narrative durch Kultur und Kunst nicht reproduziert werden, sollten alte und neue Werke hinsichtlich ihrer Darstellung von Behinderung hinterfragt werden. Inwieweit finden sich behinderte Menschen darin wieder? Wie wird ihre Lebensrealität und ihre Perspektiven darin erzählt?
Cripping Up ist die Besetzung von Rollen mit Behinderungen durch nichtbehinderte Schauspielende. Diese Praxis wird von behinderten Aktivist*innen kritisiert, da behinderte Darsteller*innen im Kulturbetrieb und im Film noch immer stark unterrepräsentiert und marginalisiert sind. Darüber hinaus birgt Cripping Up das Risiko, dass die komplexen gelebten Erfahrungen behinderter Menschen nicht angemessen, sondern klischeehaft dargestellt werden, insbesondere wenn auch „hinter den Kulissen“ keine Kulturtätigen mit Behinderung arbeiten.
Weiterführende Links:
- Wörterbucheintrag: Cripping Up
- Konrad Wolf: Cripping up: Wenn nicht-behinderte Schauspieler*innen Menschen mit Behinderung spielen (Interview mit den Schauspielerinnen Jana Zöll und Lucy Wilke)
- 2. Folge unseres Podcasts „Rampenlicht“ – Rebecca Maskos spricht mit Jana Zöll und Noa Winter u.a. über Rollenangebote für Schauspielende mit Behinderung und mangelnde Barrierefreiheit an Schauspielschulen
6. Frühzeitige Planung – Je eher, desto besser
Ein fertiges Produkt barrierefrei zu gestalten, ist immer teurer als Barrierefreiheit von Anfang an einzuplanen. Für die Arbeit im Kulturbereich heißt das, dass schon in der Ausschreibung von Fremdleistungen (z.B. Programmierung von Webseiten, Ausstellungsgestaltung, Design von Flyern) Barrierefreiheit als notwendige Anforderung enthalten sein muss. Ebenso bedeutet es, dass im Kostenplan entsprechende Mittel für die Umsetzung von Barrierefreiheit eingeplant werden müssen. Das nachträgliche Einwerben von Mitteln für Barrierefreiheit ist schwierig und häufig nicht möglich. Da Barrierefreiheit überwiegend von externen Dienstleistern umgesetzt wird, empfiehlt es sich, im Vorfeld Angebote einzuholen, um mit passenden Zahlen kalkulieren zu können.
Wenn in der eigenen Institution nicht genügend Wissen vorhanden ist, sollte schon während der Planung Kontakt zu behinderten Expert*innen oder zu Organisationen gesucht werden, die bereits Erfahrung in der Umsetzung von Barrierefreiheit haben.
Barrierefreiheit und eine inklusive Arbeitspraxis sind Querschnittsaufgaben für eine Kultureinrichtung und betreffen demnach die Arbeit aller Abteilungen. Statt erst das „reguläre“ Kulturangebot zu planen und im Nachhinein mühevoll nach einer barrierefreien Umsetzung zu suchen, ist es empfehlenswert, von Beginn an ein barrierefreies Programm zu planen.
7. Selbstbestimmung und Selbständigkeit als Ziel der Barrierefreiheit
An welchem Teilhabebegriff orientieren wir uns, wenn barrierefreie Maßnahmen geplant werden? Qualitativ hochwertige Barrierefreiheit ermöglicht behinderten Personen Selbstbestimmung und Selbständigkeit. Allerdings sind Selbständigkeit und Selbstbestimmung nicht das gleiche. Eine Person kann durch die Hilfe einer Assistenz handeln und entscheiden, dann ist sie zwar nicht selbstständig, aber dennoch selbstbestimmt.
Wenn es als behinderte Person notwendig ist zu klingeln, bevor eine mobile Rampe angelegt wird, handelt es sich nicht um eine selbstständige Teilhabe, da die Person auf fremde Hilfe angewiesen ist. Eine Rampe sollte idealerweise auch ohne Aufforderung verfügbar sein. Anstatt einer blinden Person Texte vorzulesen, sollte die Person die Texte in barrierefreier Form bekommen, d.h. in Brailleschrift oder digital und screenreader-optimiert. So kann sie selbst entscheiden, in welcher Geschwindigkeit sie die Inhalte rezipieren will, ob sie einen Absatz überspringen will etc. Hilfsbereitschaft und Assistenz können wichtig sein, aber sie dürfen nie das Bemühen um Barrierefreiheit ersetzen, da sonst die Selbstbestimmung der behinderten Person eventuell begrenzt wird. Barrierefreiheit kann auch entlastend sein. Wenn zum Beispiel das Aufsichtspersonal im Museum immer wieder nach dem Weg zur Toilette gefragt wird, ist das ein Hinweis darauf, dass das Leitsystem seinen Zweck nicht erfüllt.
Weiterführende Links:
- Dorothee Meyer und Bettina Lindmeier für die Bundeszentrale für politische Bildung: Das Leitprinzip der Selbstbestimmung
8. Vermeiden, mit Checklisten zu arbeiten
Checklisten sind verlockend, weil sie scheinbar alle nötigen Schritte und Aspekte zum Erreichen eines Ziels übersichtlich auflisten. Allerdings verzerren Checklisten auch das Bild der Realität. So gibt es im Bereich der Barrierefreiheit oft Checklisten, die Maßnahmen nach „Behinderungsarten“ kategorisieren wie „Hören“, „Sehen“, „Bewegen“, „Verstehen“. Viele Menschen mit Behinderung und chronischen Krankheiten finden sich in diesen Kategorien nicht wieder. Gleichzeitig sind auch die Kategorien selbst zu grob. Es macht z.B. einen großen Unterschied, ob eine Person blind geboren ist und als Kind die Brailleschrift gelernt hat oder ob sie im hohen Alter erblindet ist und sich ihr Leben lang mit den Augen orientiert hat.
Viele Behinderungen sind nicht sichtbar und die Mitarbeitenden einer Kultureinrichtung wissen in der Regel nicht, wer im (zukünftigen) Publikum welche Behinderung haben könnte. Anstatt Menschen durch Checklisten in Zielgruppen und Arten der Beeinträchtigung einzuteilen, kann es sich lohnen, mehr über die Arten des Zugangs, Auswahlmöglichkeiten und individuelle Anpassungen nachzudenken. Neben der Bereitstellung von grundständigen Tools für Barrierefreiheit, wie z.B. stufenlosen Zugängen und barrierefreien Toiletten, sind Ansprechbarkeit und Flexibilität wichtige Maßnahmen, um Partizipation zu ermöglichen.
Weiterführende Links:
- Bundesfachstelle Barrierefreiheit – eine große Sammlung an Leitfäden
- Servicestelle Inklusion im Kulturbereich (Sachsen): Das Handbuch zu inklusiver und barrierfreier Kulturarbeit
- Sozialhelden: Ramp Up Me – wichtige Hinweise zu barrierefreier Veranstaltungsplanung
- Unlabel: Kreative und künstlerische Tools für die inklusive Kulturarbeit
- Leitfaden: Relaxed Performance
9. Ressourcen einplanen
Für die Umsetzung von Barrierefreiheit braucht es nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Zeit und Wissen. Finanzielle Mittel für Barrierefreiheit können häufig in Projektanträgen budgetiert werden, weitere Fördermöglichkeiten, die ausschließlich für Barrierefreiheit beantragt werden können, sind uns nicht bekannt (wir freuen uns aber über Hinweise). Können Kosten zur Herstellung von Barrierefreiheit nicht im Projektantrag budgetiert werden, lohnt es sich, den Fördergebenden hierzu Feedback zu geben, um sie mit in die Verantwortung zu nehmen. Auf keinen Fall dürfen Barrierefreiheitskosten vom künstlerischen Budget abgezogen werden und die Summe für die künstlerische Produktion dadurch reduziert werden. Dies bedeutet einen Nachteil für behinderte Menschen. Die Förderpraxis sollte unbedingt dahingehend überarbeitet werden.
Neben finanziellen Mitteln braucht es auch personelle Ressourcen. Wenn Sie zum Beispiel eine Veranstaltung mit Verdolmetschung in Deutsche Gebärdensprache planen, kostet das nicht nur Geld. Eine Person in Ihrem Team muss Angebote einholen, den Kontakt mit den Dolmetschenden halten, sie informieren und den Ablauf der Veranstaltung entsprechend organisieren. Gleichzeitig braucht mindestens eine Person im Team Wissen darüber, wie die Veranstaltung beworben wird und wie die Community der Tauben bzw. gehörlosen Personen erreicht werden kann. Fort- und Weiterbildungen zum Thema Barrierefreiheit sind ebenfalls wichtig und kosten Zeit, die im Vorfeld eingeplant werden sollte.
Weiterführende Links:
- DGS … was?! Leitfaden für Referent*innen bei Veranstaltungen mit DE-DGS-Verdolmetschung
- Tipps für Veranstaltungen mit DGS
10. Beratung suchen, Kooperationen eingehen
Der Slogan „Nichts über uns ohne uns“ ist ein zentraler Grundsatz der Behindertenrechtsbewegung und zielt auf Selbstbestimmung ab. Er bringt zum Ausdruck, dass behinderte Menschen nicht erst am Ende einer Entscheidung oder Planung informiert werden, sondern von Anfang an in alle Prozesse einbezogen werden müssen. Im Idealfall ist Ihr Team divers und verfügt auch über Erfahrung im Bereich Behinderung. Gleichzeitig ist aber nicht jede Person mit Behinderung automatisch Expert*in für Barrierefreiheit im umfassenden Sinn. Es kann daher sinnvoll und notwendig sein, sich externe Kompetenz ins Team zu holen. Das kann ein Verein der Behindertenselbsthilfe sein, ein Beratungskollektiv, das von Menschen mit Behinderung geleitet wird, oder ein Beirat aus Personen der Stadtgesellschaft. In jedem Fall sollten diese externen Parteien nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern möglichst früh viel mitentscheiden können. Im besten Fall kann eine Kooperation eingegangen werden, die auch für den künstlerischen Prozess fruchtbar ist und dabei unterstützt, ein Publikum mit Behinderung zu erschließen.
11. Diskriminierungsschutz aufbauen
Einen wirksamen Diskriminierungsschutz im Haus zu etablieren, ist nicht nur rechtlich verpflichtend, sondern beugt Diskriminierung nachhaltig vor. Auf der Ebene des Personals muss es z.B. eine Schwerbehindertenvertretung in der Kultureinrichtung geben, wenn mindestens fünf schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Mitarbeiter*innen länger als sechs Monate beschäftigt sind (SGB IX § 177). Nach § 13 AGG ist eine AGG Beschwerdestelle verpflichtend, um Mitarbeitende vor Diskriminierung zu schützen. Aber auch eine Hausordnung, ein Leitbild und/oder ein Code of Conduct geben einen Rahmen vor, welche Handlungen und Aussagen toleriert werden und auf welche Arbeitskultur sich Mitarbeitende berufen können. Bei Verstößen sind Konsequenzen angebracht. Für das Publikum sollte es ebenfalls eine Stelle geben, bei der Feedback, Lob und Kritik gesammelt werden. Das sollte auf verschiedenen Wegen und auch anonym möglich sein. Nur so können sich Menschen mit Behinderung und andere marginalisierte Personen sicher und willkommen fühlen.
Weiterführende Links:
- „Awareness im Kulturbereich“ Wegweiser für achtsame Veranstaltungen
- Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.): Hilfe bei Diskriminierung im Arbeitsleben – Fragen, Antworten und Tipps für Betroffene
- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Hrsg.): Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Hrsg.): Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
12. Nachhaltig arbeiten, Verantwortung teilen
Barrierefreiheit und das entsprechende Wissen dazu müssen nicht immer wieder neu erarbeitet werden, das ist mühevoll und kostet wertvolle Ressourcen. Auch wenn ein*e Access-Manager*in2 den Hut aufhat, ist es ratsam, dass das Wissen zur Barrierefreiheit nicht nur bei einer Person liegt. Zu Fachfragen kann Expert*innenwissen unabdingbar sein, dennoch sollte das gesamte Team ein Grundwissen zu Barrierefreiheit haben. Sie können regelmäßig Fortbildungen und Workshops anbieten, sodass mit dem Weggang einer Person nicht das komplette Wissen verloren geht. Aus diesem Grund sind feste Stellen im Stellenplan der Institution auch nachhaltiger als immer wieder temporäre Projektstellen mit wechselnder Besetzung. Achten Sie beim Besetzen neuer Stellen darauf, dass die Bewerber*innen auch Erfahrungen und Wissen im Bereich Barrierefreiheit und Inklusion nachweisen. Ebenso kann es sinnvoll sein, Dokumentationssysteme anzulegen, die zum Nachschlagen genutzt werden können.
Bei der Herstellung von Barrierefreiheit lassen sich Ressourcen sparen, wenn Systeme miteinander kompatibel sind und Inhalte leicht ausgetauscht und verknüpft werden können. Wenn Sie z.B. die Wandtexte einer Ausstellung ohnehin in digitaler Form besitzen (da sie die Grundlage für die gedruckten Texte sind), können Sie diese auch dem Publikum in digitaler Form zugänglich machen. Wenn Sie eine Online-Veranstaltung live übertragen, kann diese aufgezeichnet und nachträglich als Dokumentation angeboten werden (vorausgesetzt die Beteiligten stimmen dem zu). Inhalte zeit- und ortsunabhängig nutzen zu können, ist auch ein wichtiger Aspekt von Barrierefreiheit.
- 1Vgl. Köbsell, S. (2016): Doing Dis_ability: Wie Menschen mit Beeinträchtigungen zu „Behinderten “werden. In: Managing Diversity: Die diversitätsbewusste Ausrichtung des Bildungs- und Kulturwesens, der Wirtschaft und Verwaltung, S. 93 ff.
- 2Access-Manager*in (ins Deutsche übersetzt ungefähr Zugangsbeauftragte*r) meint eine Person, die innerhalb einer Organisation damit beauftragt ist, Barrierefreiheit u.a. für Veranstaltungen herzustellen. In vielen Organisationen hat sich dafür der englische Begriff durchgesetzt.