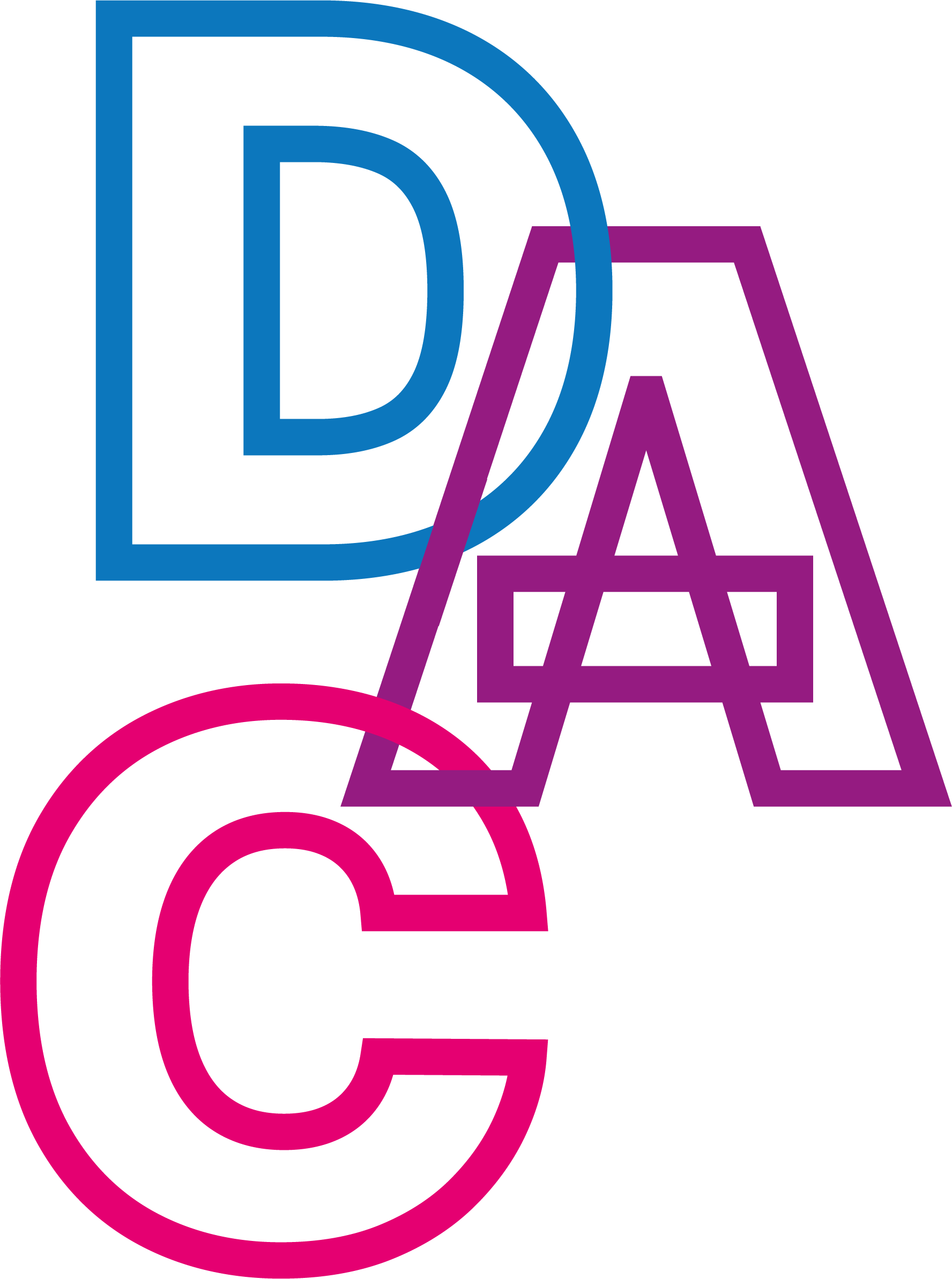Neurodiversität, Neurodivergenz
[ˌnɔʏ̯ʁoˌdiːvɛʁziˈtɛːt, ˌnɔʏ̯ʁoˌdiːvɛʁˈɡɛnts]
Neurodiversität, Neurodivergenz
Neurodiversität ist ein Konzept, das interindividuelle Unterschiede in neurologischen Strukturen, die von der Medizin oder der Psychologie als Störungen eingestuft werden, als Aspekt menschlicher Vielfalt betrachtet. Neurologische Strukturen im Sinne der Neurodiversity-Bewegung meint „nicht nur […] Denkprozesse, sondern […] alle Wahrnehmungs-, Handlungs- und Denkweisen“.1 Neben der Vielfalt von Gehirnen und neuronalen Verbindungen sollen auch die Abweichung von typischer Wahrnehmung und Reaktionen auf die Welt anerkannt werden. Das Konzept ist noch relativ jung und es gibt bisher keine einheitliche beziehungsweise verbindliche Definition.
Im Kern geht es bei Neurodivergenz darum, die vielfältigen neurokognitiven Ausprägungen, die Menschen haben, wertfrei als Teil einer natürlichen Vielfalt anzuerkennen. Neurodivergent ist eine Selbstbezeichnung, die Personen wählen, wenn bestimmte neurokognitive Prozesse bei ihnen nicht der normativen Vorstellung eines „normal funktionierenden Gehirns“ entsprechen. So beschreiben sich z. B. Menschen mit ADHS, Legasthenie oder Tourette-Syndrom oder Autist*innen als neurodivergent. Vertreter*innen des Neurodiversitätskonzepts lehnen die Pathologisierung ihrer neurobiologischen Unterschiede als Krankheit oder Störung ab und fordern stattdessen, dass die Andersartigkeit ihres Denkens und Wahrnehmens als Bereicherung für die Gesellschaft wertgeschätzt wird. Therapie und medizinische Behandlung als Folge der Pathologisierung werden teilweise abgelehnt.
Das Konzept der Neurodivergenz ist aus einer sozialen Bewegung hervorgegangen. Frühe Vertreter sind z.B. der Autist Jim Sinclair oder der Journalist Harvey Blum, die schon in den 1990er Jahren Autismus als eine Form neurologischer Variation diskutierten. Die australische Soziologin Judy Singer umschreibt mit dem Begriff Neurodiversität ihr eigenes Verhalten und das ihrer Familie als von der Norm abweichend.2 Singer fordert, Neurodiversität als Identitätsbewegung anzuerkennen und verortet sie unter dem Schirm des sozialen Modells von Behinderung, das Behinderung als Wechselwirkung zwischen beeinträchtigten Menschen und einer ausschließenden Gesellschaft definiert. „The ‚neurologically different‘ represent a new addition to the familiar political categories of class/ gender/ race and will augment the insights of the social model of disability.“3 (auf Deutsch: „Die ‚neurologisch Anderen‘ stellen eine neue Ergänzung zu den bekannten politischen Kategorien Klasse/ Geschlecht/ Rassismuserfahrung dar und werden die Erkenntnisse des sozialen Modells von Behinderung erweitern.“)
Dennoch wird die Frage, inwieweit Neurodiversität als eigenständige Kategorie besteht oder in Übereinstimmung mit dem sozialen Modell als Behinderung eingeordnet wird, innerhalb der Neurodiversity-Community unterschiedlich bewertet.
Neurodiversität im Kulturbereich
Das Konzept der Neurodiversität ist mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum angekommen und wird im Kunst- und Kulturbereich auf unterschiedlichen Ebenen aufgegriffen. So gibt es ein steigendes Bewusstsein für die Barrieren eines neurodivergenten Publikums, aus dem z.B. das Format der Relaxed Performance hervorgegangen ist. Relaxed Performances bieten ein entspannteres und reizärmeres Theaterformat an. Im Kontext von künstlerischer Ausbildung und Kulturförderung werden zumindest vereinzelt die Zugangsbarrieren für neurodivergente Künstler*innen in den Blick genommen.4 Darüber hinaus ist Neurodiversität im künstlerischen Diskurs angekommen und wird vielfach künstlerisch verhandelt und diskutiert.5 So beschreibt die britische Künstlerin Jess Thom ihr Tourette-Syndrom als eine Art Linse, durch die sie auf besondere Weise ihre Kreativität erforschen kann.6
- 1Lindmeier, C., Grummt, M. & Richter, M. (2023) Neurodiversität und Autismus. Stuttgart: Kohlhammer, S. 11.
- 2Vgl. Lindmeier, C., Grummt, M. & Richter, M. (2023) Neurodiversität und Autismus. Stuttgart: Kohlhammer, S. 15ff.
- 3Singer, J. (1999) ‘Why can’t you be normal for once in your life? From a “problem with no name” to the emergence of a new category of difference’, in Corker, M. & French, S. (Hrsg.) Disability Discourse. Buckingham: Open University Press, S. 59–67, hier S. 64.
- 4Siehe auch das Angebot der Universität der Künste diesbezüglich: https://www.udk-berlin.de/studium/studium-generale/kurse-courses/interdisziplinaere-kuenstlerische-praxis-und-theorie-wise-2024-25/network-neurodiversity-netzwerk-neurodiversitaet/, zuletzt aufgerufen: 02.10.2025.
- 5Siehe auch das britische Kollektiv Project Art Works, das zu Neurodiversität arbeitet: https://documenta-fifteen.de/lumbung-member-kuenstlerinnen/project-art-works/, zuletzt aufgerufen: 02.10.2025.
- 6Vgl. Interview mit Jess Thom im New Scientist (Paywal): https://www.newscientist.com/article/mg22830483-200-biscuit-hedgehog-how-my-tourettes-tics-are-a-creative-catalyst/, zuletzt aufgerufen: 09.10.2025.