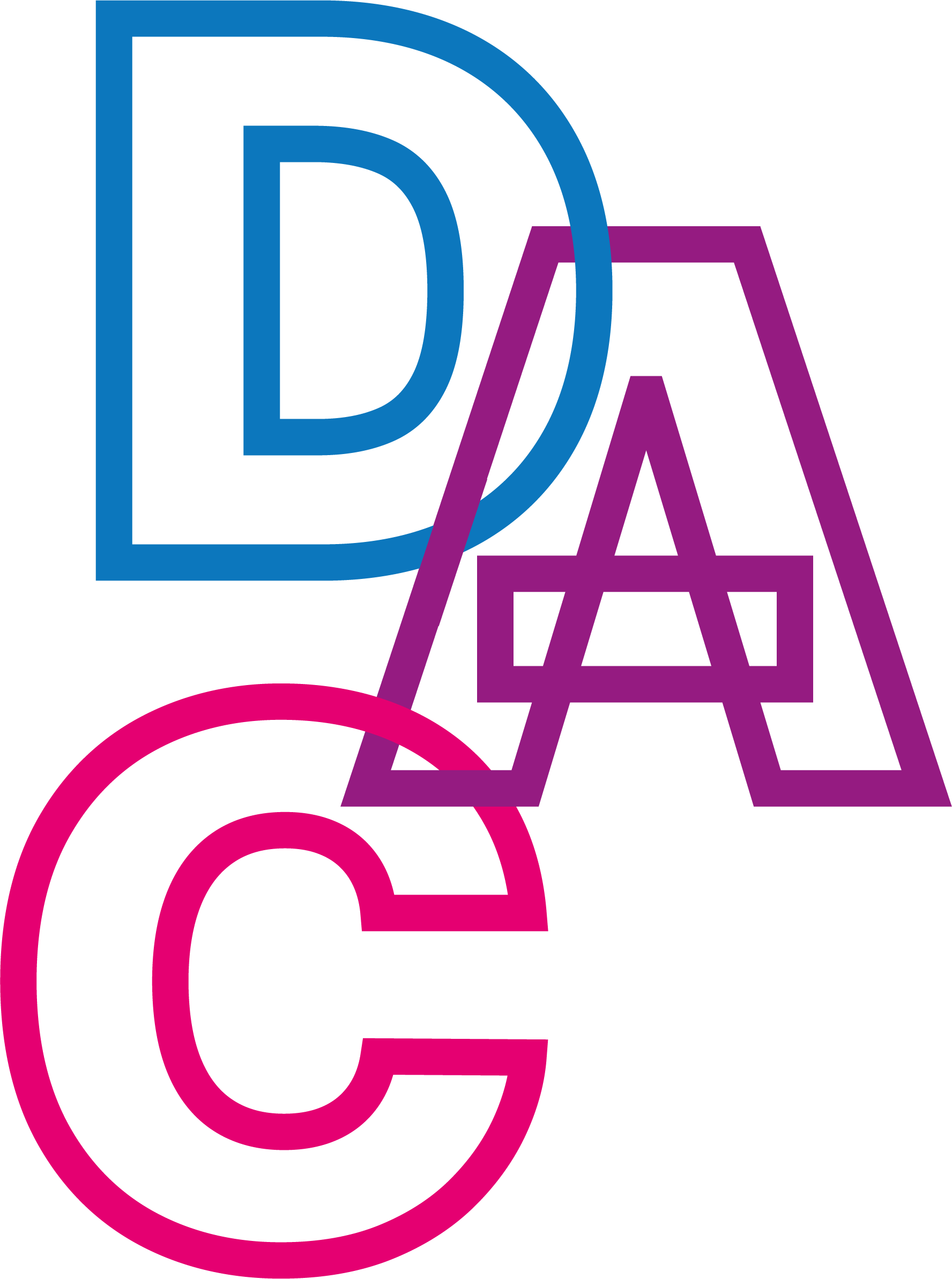Diskriminierung
[dɪskʁiˌmiːni̯ʁʊŋ]
Diskriminierung
Der Begriff Diskriminierung (lateinisch für ‚abgrenzen‘, ‚unterscheiden‘) bezeichnet die Benachteiligung, Ausgrenzung oder Herabwürdigung von Menschen aufgrund persönlicher – tatsächlicher oder zugeschriebener – Merkmale.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zählt hierzu die Merkmale Alter, Behinderung, „rassistische Zuschreibung“ und ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion und sexuelle Identität. Im Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz werden darüber hinaus die Merkmale chronische Erkrankung, sozialer Status und Sprache aufgeführt. Es gibt natürlich weitere Merkmale, die zu Diskriminierung führen, jedoch sind diese gesetzlich nicht oder weniger gut geschützt.
Die Grundlage für diskriminierende Handlungen und Strukturen ist die Konstruktion einer gesellschaftlichen Norm, die entlang von Binaritäten (also Zweiteilungen) zu Ein- und Ausschlüssen führt. In vielen westlichen Kulturräumen ist diese Norm männlich, weiß, heterosexuell, nicht behindert und akademisch gebildet. Menschen, Werke oder Ideen, die von dieser Norm abweichen, werden als andersartig, exotisch oder irrelevant wahrgenommen.
Diese Form der Abwertung beruht auf historisch gewachsenen Machtverhältnissen. Ein Beispiel dafür ist der europäische Kolonialismus im 19. Jahrhundert: Die Abwertung nichteuropäischer Menschen und ihrer Kunst als „primitiv“ diente dazu, politische und gesellschaftliche Unterdrückung zu legitimieren. Viele koloniale Machtstrukturen wirken bis heute nach.
Diskriminierung kann auf verschiedenen Ebenen geschehen. Hierzu gehören die individuelle, die institutionelle und die strukturelle Ebene.
Als individuelle Diskriminierung wird diskriminierendes Handeln von Einzelpersonen bezeichnet. Mit institutioneller Diskriminierung ist die in den Strukturen und Prozessen von Organisationen verankerte, merkmalbedingte Benachteiligung gemeint. Strukturelle Diskriminierung hingegen bezeichnet Diskriminierung, die in gesamtgesellschaftliche Machtverhältnisse und Zuschreibungen eingebettet ist.
Alle drei Ebenen von Diskriminierung können Menschen auch im Bereich Kunst und Kultur begegnen. Auf individueller Ebene etwa durch Mobbing am Arbeitsplatz. Ein Beispiel für institutionelle Diskriminierung sind Förderprogramme, die keinen barrierefreien Zugang für behinderte Antragsteller*innen bieten. Auf struktureller Ebene findet sich Diskriminierung beispielsweise in Form von mangelnder Rollenvielfalt für Schauspieler*innen of Color.
Diskriminierungen auf individueller und institutioneller Ebene können absichtlich oder unabsichtlich geschehen.
Eine weitere Unterscheidung findet zwischen unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung statt. Eine direkte Benachteiligung aufgrund eines Merkmals wird als unmittelbar bezeichnet. Wenn scheinbar neutrale Regelungen Benachteiligungen herbeiführen, handelt es sich dagegen um mittelbare Diskriminierung – beispielsweise können Bewerbungsprozesse, die Gespräche in Präsenz am frühen Morgen erfordern, oder Theaterproben, die bis spät in die Nacht andauern, Menschen, die sich um andere Menschen kümmern (Sorgearbeit), benachteiligen.
Wichtig für das Verständnis von Diskriminierung ist außerdem der Begriff der Intersektionalität. Er beschreibt, dass Menschen nicht nur aufgrund eines einzelnen Merkmals, sondern auch an der Schnittstelle von mehreren Merkmalen Diskriminierung erfahren. Ein Beispiel für intersektionale Diskriminierung sind Einlasskontrollen: Wenn am Eingang eines Clubs überwiegend junge Schwarze Männer abgewiesen werden, findet die Diskriminierung nicht entlang der Einzelmerkmale Alter, „rassistische Zuschreibung“ oder Geschlecht statt. Erst die spezifische Kombination der drei Merkmale führt in diesem Fall zur Diskriminierung.
Diskriminierung beinhaltet zudem oft eine Stereotypisierung: Das heißt, bevor es zu diskriminierenden Handlungen kommt, werden Menschen auf Basis persönlicher Merkmale gedanklich in Gruppen eingeteilt. Dabei werden die Eigenwahrnehmung und Positionierung der betroffenen Personen ignoriert. Den Mitgliedern dieser Gruppen werden dann meist negative Eigenschaften zugeschrieben. Diese Eigenschaften werden oftmals als unveränderlich wahrgenommen und damit an das jeweilige persönliche Merkmal gekoppelt. Hierdurch wird Menschen ihre Individualität sowie Entwicklungsfähigkeit abgesprochen. Gesellschaftlichen Gruppen negative Eigenschaften zuzuschreiben, geht dabei nicht nur von Einzelpersonen aus, sondern kann in Institutionen oder gesamtgesellschaftlich etabliert sein.
Diskriminierung in Kunst und Kultur
Kunst und Kultur haben eine doppelte Rolle im Kontext von Diskriminierung. Einerseits spiegeln sie gesellschaftliche Ausschlüsse wider. Durch eine Fokussierung auf einen Kanon westlicher, männlicher oder nichtbehinderter Künstler*innen, deren sogenannte Exzellenz der „primitiven“ Kunst von Künstler*innen aus marginalisierten Communitys gegenübergestellt wird, besteht die Gefahr, dass auch Kunst und Kultur diese Abwertung reproduzieren. Die Besetzung von Entscheidungsgremien in Kulturinstitutionen und welche Perspektiven in ihnen vertreten sind bzw. von ihnen berücksichtigt werden, ist eine wichtige Stellschraube, um Diskriminierung vorzubeugen. Wichtig ist daher für die Arbeit von Jurys, Kurator*innen und künstlerischen Leitungen, sich diskriminierungskritisch mit der eigenen Arbeit auseinanderzusetzen und Wissen über diversitätssensible Praxis zu erlangen.
Gleichzeitig bieten Kunst und Kultur Raum für Kritik an gesellschaftlichen Barrieren und für Emanzipation. Viele Künstler*innen nutzen ihre Arbeit, um erlebte Diskriminierung zu verhandeln, auf Ausschlüsse aufmerksam zu machen, Machtverhältnisse zu hinterfragen und alternative Narrative zu schaffen.
Wege, Diskriminierung zu begegnen und zu bekämpfen, finden sich für Betroffene in rechtlichen Grundlagen wie dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und im Berliner Landes-Antidiskriminierungsgesetz (LADG). Kulturtätige bzw. Kulturinstitutionen können im Rahmen von Empowerment-Programmen oder Awareness-Maßnahmen Ausschlüsse abbauen. Konkrete Handlungsempfehlungen in Diskriminierungsfällen lassen sich zudem mit der Hilfe von Beratungsstellen im Zuge einer Antidiskriminierungsberatung erarbeiten. Wir bieten eine solche Beratung für Berliner Kulturtätige an. Hier haben wir eine Übersicht über weitere Antidiskriminierungsstellen bereitgestellt.
Quellen und weiterführende Literatur
- Universität Potsdam (Hrsg.): Was ist Diskriminierung?
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Hrsg.): Was ist Diskriminierung?
- Martina Thiele für die Bundeszentrale für politische Bildung: Medien und Stereotype
- Ulrike Hormel und Albert Scherr (Hrsg.): Bildung für die Einwanderungsgesellschaft: Perspektiven der Auseinandersetzung mit struktureller, institutioneller und interaktioneller Diskriminierung