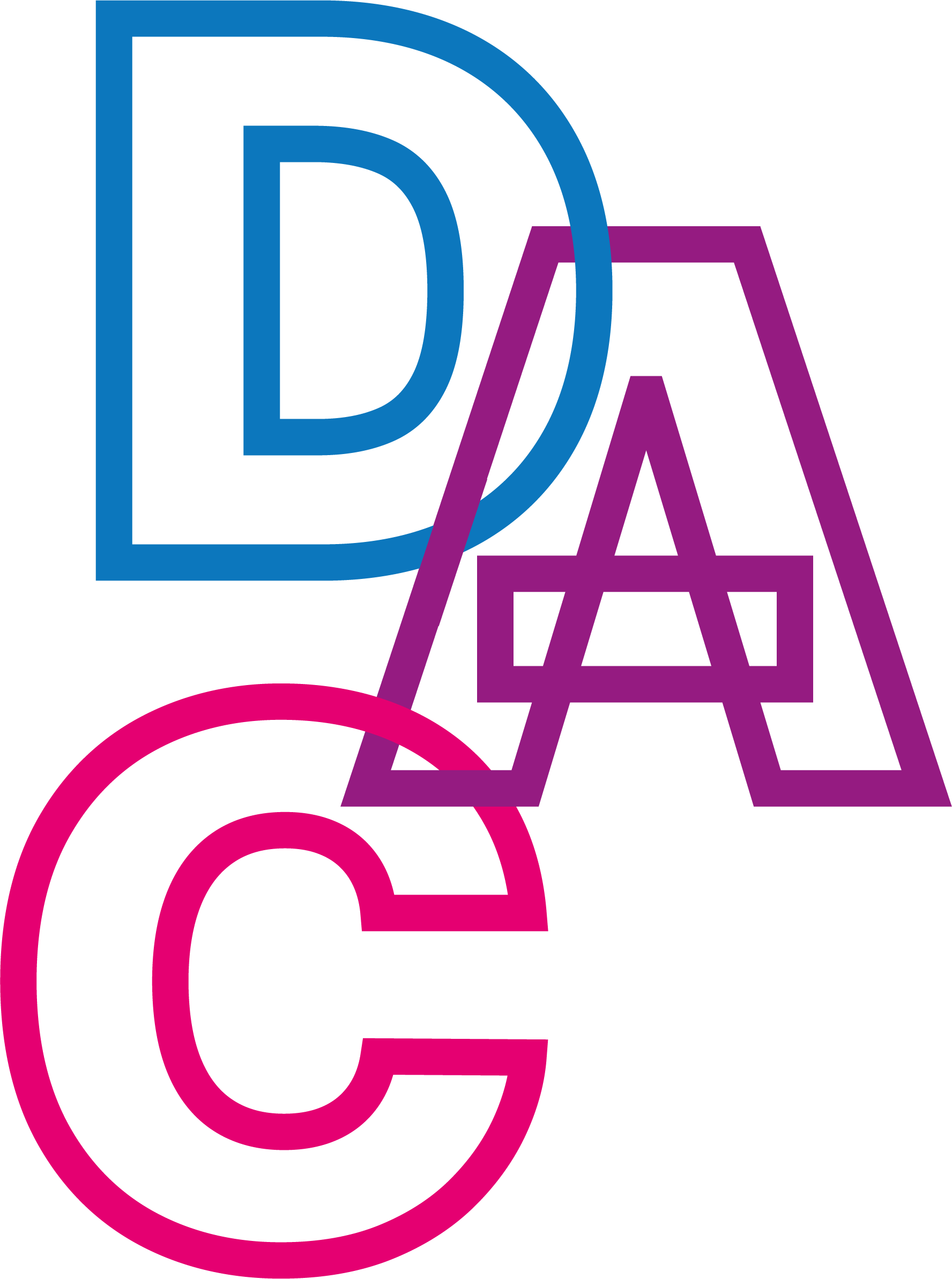Selbst- und Bildbeschreibungen
Für die Kommunikation mit blinden und sehbehinderten Menschen
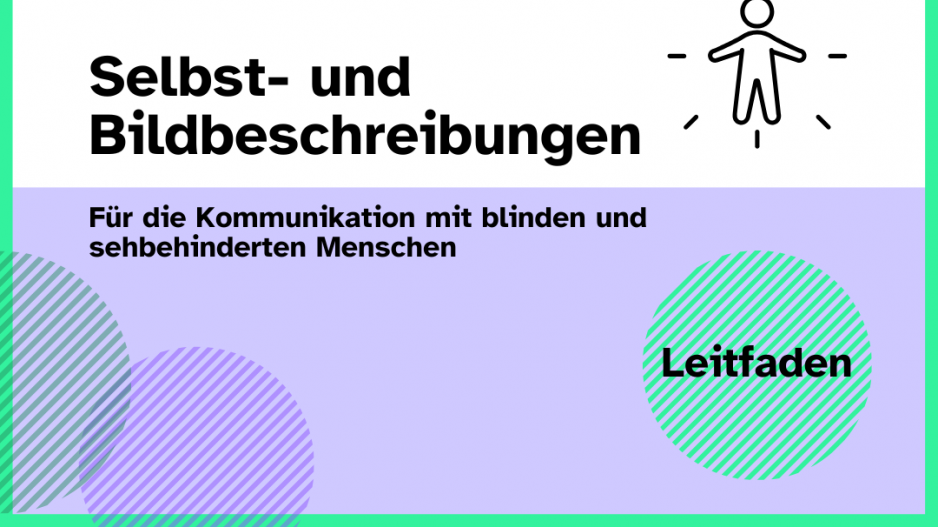
Infos zur Selbstbeschreibung
Es ist üblich, sich selbst zu beschreiben, wenn man mit blinden oder sehbehinderten Menschen zusammenkommt. Es ist wichtig, weil blinde oder sehbehinderte Menschen keine oder nur eingeschränkte visuelle Informationen über das Gegenüber bekommen. Die Selbstbeschreibung hilft dabei, sich zu positionieren und zu erklären, wer man ist. Dabei muss es nicht nur um das Aussehen gehen, sondern es können auch im jeweiligen Kontext relevante nicht sichtbare Merkmale freiwillig benannt werden (Beispiele: Pronomen, Behinderung oder soziale Herkunft).
Warum ist eine Selbstbeschreibung wichtig?
Eine Selbstbeschreibung hilft blinden oder sehbehinderten Menschen, eine Vorstellung von Personen zu entwickeln und liefert Informationen, die sehende Personen visuell aufnehmen. Dadurch wird ein gleichberechtigter Zugang zu Informationen ermöglicht und eine inklusivere und respektvollere Kommunikation gefördert. Außerdem können Selbstbeschreibungen den blinden oder sehbehinderten Personen dabei helfen, sich an die anderen Teilnehmenden zu erinnern und sie bei späteren Treffen wiederzuerkennen. Wenn Teilnehmende bzw. die Durchführenden einer Veranstaltung eine Selbstbeschreibung abgeben, können sich die anwesenden blinden oder sehbehinderten Menschen auch ein Bild der Vielfalt bzw. des Mangels an Vielfalt bei der Veranstaltung machen.
How To
- Nenne zu Beginn einer Unterhaltung bzw. bei der Vorstellung den eigenen Namen und Beruf/Institution/Einrichtung.
- Falls aus Nr. 1 nicht klar: Welchen Bezug hast du zum Thema/Kontext?
- Gib eine kurze prägnante Beschreibung zu dir ab: Dabei entscheidest du selbst, was du wann über dich preisgeben möchtest und was dir in dem Moment und vorhandenen Personenumfeld wichtig ist, mitzuteilen. Nenne wichtige visuelle Merkmale. Achte darauf, dich nicht in Detailbeschreibungen zu verlieren.
Möglichkeiten der Selbstbeschreibung und -positionierung
- Geschlecht – Stimmen werden oft vergeschlechtlicht. Eine Selbstbeschreibung bietet dir die Möglichkeit, zu sagen, wie du dich positionierst, und beispielsweise Angaben zu deinen Pronomen zu machen. Neben Pronomen – zum Beispiel „er“, „sie“ oder „they“ – kannst du angeben, ob du eine cis- oder trans-Person bist. Cisgender beschreibt eine Person, deren Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt.
- Alter – Benutze bei Bedarf einen Altersabschnitt, statt das genaue Alter (Beispiel: Anfang 20, Mitte 50). In vielen Kontexten können Menschen aufgrund ihres Alters in stereotype Kategorien eingeordnet oder benachteiligt werden. Nenne also gerne einen Altersabschnitt statt deines genauen Alters, wenn du dich damit wohler fühlst.
- Nicht sichtbare Behinderungen/Erkrankungen/Neurodivergenz – Je nach Kontext kann es Sinn machen, sich zu diesen nicht-sichtbaren Aspekten zu äußern. Du musst es aber auf keinen Fall! Vermeide insbesondere als nicht betroffene Person ableistische (Menschen mit Behinderungen diskriminierende) Wörter wie „normal“.
- Sichtbare Behinderungen/Erkrankungen: Du kannst sichtbare Behinderungen/Erkrankungen benennen oder Hilfsmittel beschreiben, z.B. „Ich nutze einen Langstock“ oder „Ich nutze einen Rollstuhl“.
- Sprache/Kommunikation: Du kannst auf die von dir bevorzugte Sprache hinweisen, z.B. Deutsche Gebärdensprache, deutsche Lautsprache oder Leichte Sprache.
- Sogenannte ethnische Herkunft/Hautfarbe – Oft nennen nur Menschen, die zu einer sichtbaren Minderheit oder unterrepräsentierten Gruppe gehören, ihre Hautfarbe oder weitere Merkmale, die in einer weißen Mehrheitsgesellschaft als anders gewertet werden. Es ist wichtig, dass auch Weißsein benannt wird, um es nicht als Standard zu setzen. Darüber hinaus kannst du Besonderheiten deines Hauttons beschreiben, z.B. „Ich bin weiß und habe eine sehr helle Haut“.
- Haare – beispielsweise Farbe und Länge. Auch Gesichtsbehaarung, wie z. B. ein Bart, kann für blinde oder sehbehinderte Menschen eine nützliche visuelle Markierung darstellen.
- Körperbau/Größe – Körperliche Merkmale sind stark mit gesellschaftlichen Normen verknüpft. Deshalb sollte ihre Beschreibung achtsam erfolgen, ohne Normen zu reproduzieren. Vermeide darum Sätze wie „Ich bin normalgewichtig“, die implizieren, dass andere Körperformen nicht normal sind. Nutze konkrete Beschreibungen: „Ich definiere mich als fett“, „Ich bin muskulös“, „Ich habe lange Beine“.
- Kleidung und Accessoires – Kleidung ist Teil deiner Identität. Nenne besonders auffällige Elemente wie z.B. besonderen Schmuck, bunte Schals etc.
Beispiele
- „Ich bin ein weißer cis-Mann Mitte 50. Ich bin groß und habe ergrautes, dunkles, lockiges Haar. Mein Pronomen ist ‚er‘. Ich trage eine lange goldene Kette.“
- „Ich benutze das Pronomen ‚they‘. Ich bin eine nicht-binäre ostasiatische Person in meinen 20ern. Ich habe langes dunkles Haar und habe einen Bart.“
Tipps
- Schreib dir vorher auf, was du sagen möchtest.
- Diese Fragen können dabei helfen: Was würdest du einer fremden Person über dich mitteilen, sodass diese dich in einer Menge ausfindig machen kann?
- Nenne Namen und Beruf oder ein anderes Schlüsselelement bei jedem Wortwechsel, damit du eingeordnet und erinnert werden kannst.
- Beschränke dich auf 3 Schlüsselelemente oder 1-2 Sätze sowie auf wichtige Informationen.
- In manchen Kontexten ist eine Selbstbeschreibung jeder einzelnen Person nicht sinnvoll für jede blinde oder sehbehinderte Person. Beispielsweise, wenn Menschen aus einem großen Publikum Fragen in einem Online-Seminar stellen. Frage am besten die sehbehinderten Teilnehmenden, welche Infos für sie sinnvoll sind.
Infos zur Bildbeschreibung (beispielsweise bei Präsentationen)
How To
- Beschreibe erst einmal neutral, kurz und präzise, was zu sehen ist.
- Trage schriftliche Informationen verbal vor
- Von wem ist das Bild und hat es einen Titel? Nenne den Namen.
- Beschreibe das Format und die Art: Quer-/ Hochformat, schwarz-weiß/farbig, Perspektive: z.B. Vogel- oder Froschperspektive, Foto, Grafik, Gemälde etc.
- Beschreibe, wo im Bild welche Elemente zu sehen sind. Falls es abstrakt ist, benenne am besten, dass es kein erkennbares Objekt gibt.
- Bilder, die ausschließlich einen dekorativen Zweck haben, solltest du nicht beschreiben.
Tipps
- Springe nicht im Bild hin und her, sondern scanne das Bild „systematisch“ ab. Du kannst das Bild z.B. von vorne nach hinten oder umgekehrt beschreiben. Oder im Uhrzeigersinn oder entgegengesetzt, dabei kannst du es in Viertel aufteilen.
- Gibt es ein zentrales Motiv, nenne dieses zuerst.
- Allgemein sollten Beschreibungen kurz und neutral gehalten werden. Achte darauf, dass du zunächst beschreibst, was zu sehen ist. Erst dann kannst du auf den Kontext und/oder die Interpretation eingehen.
- Sprich in möglichst einfachen Sätzen und mache Pausen. Hier findest du Tipps und Tricks, um deine Inhalte noch verständlicher zu machen.
- Halte bei Fragen aus dem Publikum immer Blickkontakt mit der fragenden Person.
- Erprobte Beispiele von Bildbeschreibungen findest du unter diesem Link.
Spezielle Formate
Grafiken: Beschreibe, worum es geht und benenne ggf. den Titel. Stelle den Aufbau vor: Gib einen groben Überblick – zum Beispiel lässt sich die Grafik meistens in mehrere Sequenzen oder Abschnitte gliedern, die man zunächst benennen kann. Erläutere nach und nach die wichtigsten Elemente oder Prozesse.
Kunstwerke: Bei Kunstwerken vermischt sich oft Beschreibung und Interpretation des Werkes. Das erschwert eine reine Beschreibung.
- Nenne zunächst Eckdaten: Künstler*in, Titel, Genre, Format/ Maße, Material/ Technik, Entstehungszeit / Kontext, Größe
- Beschreibe neutral, was abgebildet ist. Vermeide unbewusste Wertungen oder Interpretationen (Beispiele: „ein schöner Baum“, „ein Liebespaar“ etc.)
- Gehe auf spezifische Merkmale ein, die das Werk einzigartig machen (Stil, Farbtöne).
- Du solltest erst im Anschluss an die neutrale Beschreibung eine Interpretation zum Bild bieten, sofern es in den Kontext der Bildvorstellung passt.
Barrierefreie Präsentationen
- Bei Präsentationen ist zu beachten, dass eine große, leserliche Schrift (z.B. ohne Serifen) verwendet wird, es einen klaren Aufbau gibt und ein kontrastreiches Design verwendet wird. Nutze ein einheitliches Format für die Folien statt wechselnder Hintergründe.
- Ein Bild sollte nicht zu viele Elemente enthalten.
- Statte Bilder mit Alternativtexten aus beziehungsweise beschreibe sie.
- Für weitere Informationen stellt Microsoft hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bereit, um Präsentationen mit PowerPoint barrierefrei zu erstellen.
Weitere Beschreibungen
Raumbeschreibung (für Gastgebende und Moderator*innen)
Räume zu beschreiben ist für blinde und sehbehinderte Personen wichtig, um sich zu bewegen, zu orientieren und sich den Raum vorstellen zu können. Folgende Beschreibungen können genannt werden:
- Architektur und Baustil
- Größe und Struktur von Gebäude und Räumen (Raumanzahl, Etagen, Türen)
- Wegbeschreibung zu wichtigen Orten (Toiletten, Garderobe, Aufzüge, Workshops, Verpflegung, etc.)
- Anordnung von relevanten Einrichtungsgegenständen (Tische, Stühle)
Zusätzliche Informationen zu barrierefreien Veranstaltungsorten:
- Bei Veranstaltungen solltest du vorab eine gemeinsame Raumbegehung anbieten.
- Idealerweise hat der Veranstaltungsort ein taktiles Leitsystem. Es gibt auch Möglichkeiten, vorübergehende taktile Orientierungen selbst zu erstellen: Zum Beispiel eine Schnur mit Klebeband als Markierung auf dem Boden befestigen.
- Beschriftungen und wichtige Infos solltest du in Relief- oder Brailleschrift verfügbar machen. Für weiterführende Infos kannst du einen erstastbaren QR-Code nutzen, der auf längere barrierefreie Texte verlinkt.
- Zusätzlich kannst du eine Abholung anbieten, zum Beispiel vom nächstgelegenen Bahnhof.
- Achte auf angemessene Lichtverhältnisse: Diese können je nach Bedarfen unterschiedlich ausfallen, beispielsweise helle Räume, ausreichend Kontraste, keine blinkenden Objekte etc.
- Lege im Team eine Ansprechperson fest, die bei Bedarf unterstützen und von Raum zu Raum begleiten kann.
- Bewerbung der Veranstaltung: Frage Unterstützungsbedarfe ab und biete verfügbareAngebote an. Der Kontakt und die Anmeldung sollten auf zwei Wegen angeboten werden: sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Kommuniziere Barriereinformationen transparent. Welche Zugangsmöglichkeiten gibt es und welche nicht? Die Ankündigung auf der Website sollte für Screenreader lesbar sein. Gib außerdem eine Wegbeschreibung an.
Dieser Leitfaden wurde von Diversity Arts Culture und kultur_formen erstellt. Danke an Andreas Krüger von der Berlinischen Galerie für sein Feedback zu diesem Leitfaden.
Quellen und weitere Informationen
Vocal Eyes: Selbstbeschreibung im Rahmen inklusiver Meetings
Netz-barrierefrei.de: Sollte man sich selbst in Veranstaltungen für Blinde beschreiben?
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband: Kunst anschaulich beschreibe
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband: Leserlich und lesbar
Erstes Prüfen von Barrierefreiheit einer Website: WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. Dies ersetzt nicht die detaillierte Prüfung durch eine blinde oder sehbehinderte Person.