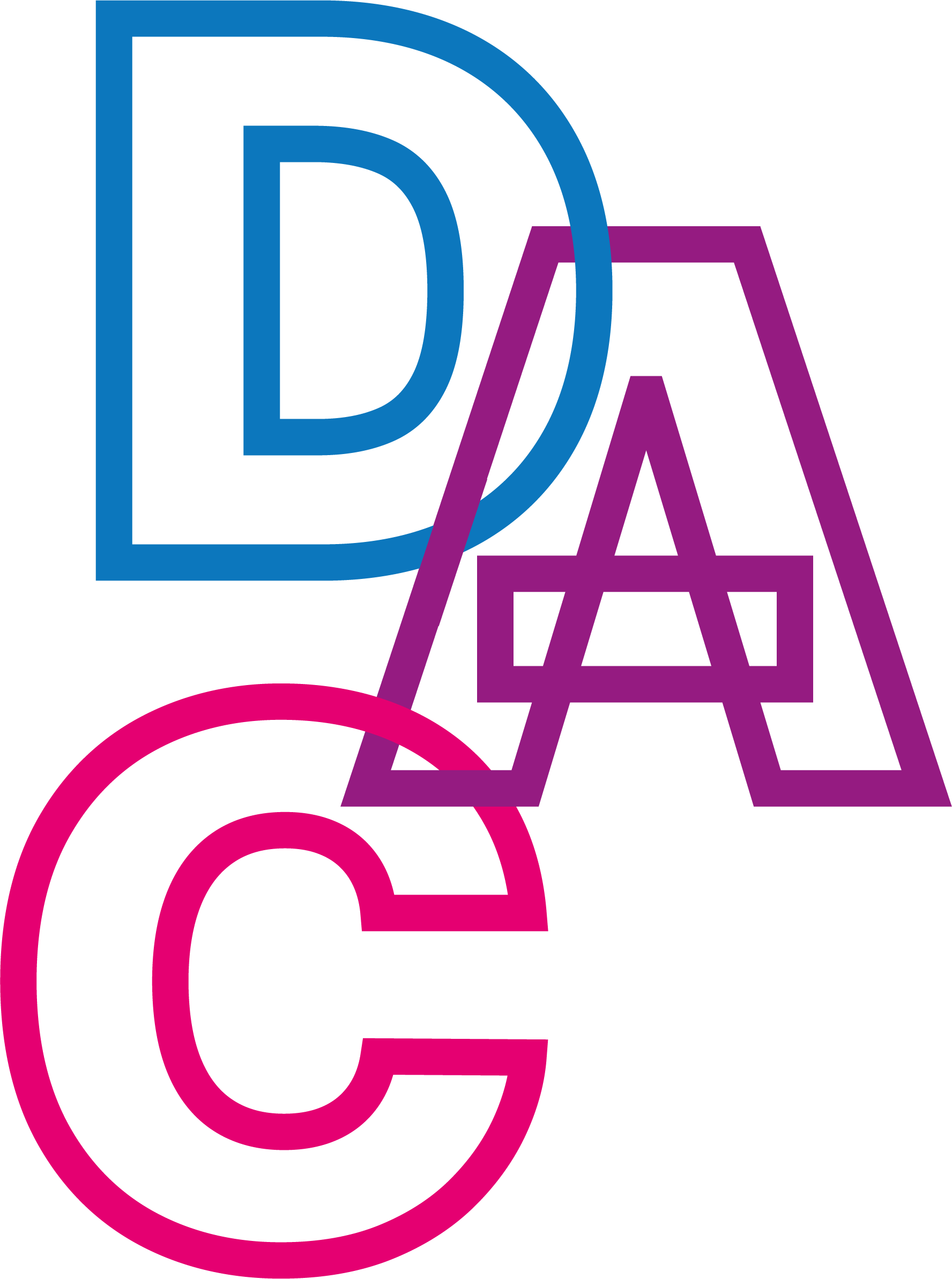Brüchige Bündnisse?
Die Kölner Tagung „Marginale Brüche: Kulturelle Produktionen von Migrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen“
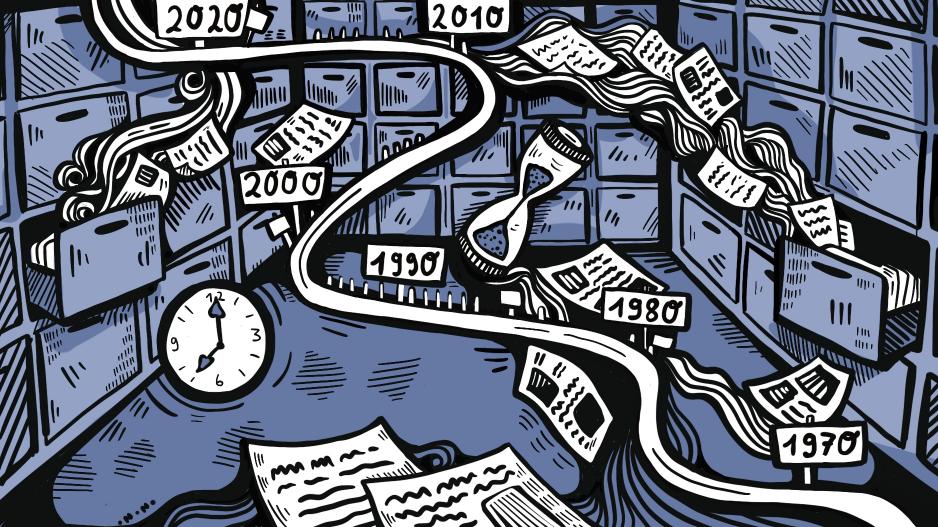
Text: Dr. Pegah Byroum-Wand
Die Tagung „Marginale Brüche“
Im November 1997 fand eine Tagung in Köln statt, die die erste ihrer Art in der Bundesrepublik war. „Marginale Brüche“ zielte darauf ab, sich mit der Kulturproduktion marginalisierter Frauen*1im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Literatur und Kunst auseinanderzusetzen. Die Tagung fand als Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung NRW (damals Ökologie-Stiftung NRW) statt und wurde anlässlich des Europäischen Jahres gegen Rassismus durchgeführt. Sie ging aus dem internationalen Arbeitskreis „wi(e)dersprache!“ hervor, der u.a. von Peggy Piesche, Kader Konuk und Cathy S. Gelbin als Forum für Migrantinnen, Schwarze und jüdische Frauen* zur Erforschung deutschsprachiger Literatur gegründet wurde.
Die Literaturwissenschaftlerinnen und Veranstalterinnen Cathy S. Gelbin, Kader Konuk und Peggy Piesche wollten den Debatten um eine vermeintlich deutsche Literaturwissenschaft und Nationalliteratur eine dezidiert feministische und intersektionale Perspektive entgegensetzen. Mit der Tagung verfolgten sie zwei Ziele. Erstens sollte die Tagung in den Mittelpunkt stellen, dass die objektifizierende und „prekäre Positionierung der Marginalisierung eben keinen Opferstatus bedeutet, sondern im Gegenteil Selbstbestimmung, Handlungsfähigkeit und Verantwortung.“2Es ist dieser selbstermächtigende Perspektivwechsel, mit dem der exklusive literarische und literaturwissenschaftliche Kanon unterlaufen wird.
Die Teilnehmenden einte ihre Abrechnung mit dieser Objektifizierung. Eigene ästhetische oder wissenschaftliche Positionen waren vorrangig dann möglich, wenn sie als Projektionsfläche für den bundesdeutschen Diskurs vereinnahmt werden konnten. Deshalb widmeten sich die Teilnehmenden zweitens den vielfältigen Strategien minorisierter Literatur. Verschiedene Panels thematisierten kritisch die im angloamerikanischen Raum und in der Literatur(wissenschaft) geführten Debatten um postkoloniale Theorien. Insbesondere das dritte Panel, „Im Kaleidoskop der Identität“, nahm theoretische Konzepte wie Hybridität, Marginalität und Identität aus literaturwissenschaftlicher Perspektive in den Blick.3Hier sollte ausgelotet werden, inwiefern diese Konzepte sich für die Arbeit von marginalisierten Wissenschaftlerinnen* und Künstlerinnen* in Deutschland eigneten.
Spannend ist, dass die Tagung künstlerische und theoretische Debatten mit Erfahrungswissen und Positionierung zusammenführte. Damit sollten weitere Anknüpfungspunkte für Bündnisarbeit und Bündnispolitiken zwischen Schwarzen, migrantischen und jüdischen Frauen* geschaffen werden.
Der Sammelband „AufBrüche“
Der 1999 aus der Tagung hervorgegangene Sammelband „AufBrüche – kulturelle Produktionen von Migrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen in Deutschland“ fasst die Vorträge der Tagung zusammen. Die künstlerischen Beiträge und Workshops konnten aufgrund ihrer medialen Aufbereitung nicht in den Sammelband aufgenommen werden. Es gibt auch ergänzende Texte, u.a. von den drei Veranstalterinnen und Herausgeberinnen des Bandes, Cathy S. Gelbin, Kader Konuk und Peggy Piesche.
Ein Teil des Sammelbands widmet sich literaturwissenschaftlichen Analysen – etwa zu Mimikry, Marginalität oder Identität in Texten von Yoko Tawada, Emine Sevgi Özdamar oder Else Lasker-Schüler. Außerdem gibt es Beiträge, die in besonderer Weise zeigen, wie in Bündnisbestrebungen – entsprechend des Titels „AufBrüche“ – Konflikte aufbrechen und (Neu)Anfänge perspektiviert werden. Bündnisse sind unerlässlich. Zugleich spiegeln sich die Macht- und Diskriminierungsverhältnisse der Gesellschaft innerhalb dieser Bündnisse wider. Kommt ein Bündnis gar nicht erst zustande, bricht ein oder gar temporär auseinander, so muss der auslösende Konflikt betrachtet werden, wie nachfolgend im Abschnitt „Ein Eklat: Aufbrüche – Einbrüche – Abbrüche“ nachgezeichnet wird. Solche Brüche sind für eine diversitätsorientierte, diskriminierungskritische Literaturwissenschaft in Deutschland ebenso wichtig wie für die feministischen Kämpfe von Schwarzen, migrierten und jüdischen Frauen* in der Gegenwart.
Das literarische Feld
Die Werke und das vielfältige Schaffen von Women* of Color wurden, mit wenigen Ausnahmen wie Emine Sevgi Özdamar, Yoko Tawada oder Libuše Moníková und Zehra Çırak, im mehrheitsgesellschaftlichen Kanon ignoriert oder rassistisch, antisemitisch und exotisierend vereinnahmt. Ihr Schaffen wurde maßgeblich aus Perspektive der Dominanzgesellschaft bewertet und in den vorherrschenden Kanon eingehegt. Dies belegen die teilweise kontroversen und essenzialisierenden Genre-Bezeichnungen in den 1980er- und 1990er-Jahren. Die Bezeichnungen erstreckten sich von ‚Gastarbeiterliteratur‘, als Fremdzuschreibung sowie als empowernde Selbstbezeichnung genutzt (Biondi und Schami 1981), bis hin zu ‚Ausländerliteratur‘ (Ackermann und Weinrich 1986). Seit den 1990er-Jahren fließen sukzessive postmigrantische und transkulturelle Perspektiven in die Debatten ein.4Dies wird an den Bezeichnungen ‚Literatur in der multikulturellen Gesellschaft‘ (Şölçün 1992), ‚Migrationsliteratur‘ (Rösch 1992) oder ‚Interkulturelle Literatur‘ (Chiellino 2000) deutlich.
Es gibt Ausnahmefälle, in denen Betroffene und marginalisierte Schriftsteller*innen sich selbst organisiert und gegenseitig unterstützt, ihre eigenen Begriffe, Geschichte(n) und Literatur geschrieben oder dafür Förderung organisiert haben. Das prominenteste Beispiel ist der Polynationale Literatur- und Kunstverein in der Bundesrepublik und Westberlin e. V. (PoliKunst Verein), der sich 1982 gründete. Doch mehrheitlich wurde die ge-anderte Literatur in den 1990ern diskursiv an einen Ort verlagert, „der sich außerhalb, jenseits oder neben dem Ort befindet, der für die sogenannten ‚Nationalliteraturen’ vorgesehen ist“.5 Es verwundert daher nicht, dass die Tagung „Marginale Brüche“ die Perspektiven von Schwarzen, migrierten und jüdischen Frauen* sowie Feministinnen* unter der Prämisse einer geteilten Ausgrenzungserfahrung zusammenzubringen versucht.
Der Sammelband zeigt, dass sich die interessierte Öffentlichkeit und Wissenschaft dieser Literatur entweder mit einem Desinteresse an ihren ästhetischen Besonderheiten annähert oder im Gegenteil mit einer ebenso verdächtigen Großzügigkeit ästhetisch mangelhaften Texten gegenüber.6Diese problematische Verschränkung löst auf der Tagung „Marginale Brüche“ einen Eklat aus, der vor dem Hintergrund einer positionierten, diskriminierungskritischen und privilegiensensiblen Auseinandersetzung mit (feministischen) Bündnissen und geteilten Erfahrungen verstanden werden kann. Gleichzeitig wird deutlich, wie viel Potenzial für Bündnisarbeit in einer transparenten Auseinandersetzung mit solchen Konflikten liegt.
Ein Eklat: Aufbrüche – Einbrüche – Abbrüche
Wie Encarnación Gutiérrez Rodríguez und Pinar Tuzcu in ihrer Einleitung zu „Migrantischer Feminismus“ (2021) schreiben, stellen die 1980er und 1990er einen Höhepunkt in der Selbstorganisation von Migrant*innen, Sinti*zze und Rom*nja7, Schwarzen, exilierten und jüdischen Frauen* dar.8Die Notwendigkeit intensiverer Selbstorganisierung wurde u.a. durch das verschärfte Ausländergesetz 1990, die Zunahme rassistischer Gewalt nach der deutschen Wiedervereinigung im selben Jahr, den rassistischen Pogromen in Rostock-Lichtenhagen und den rassistischen Mordanschlägen in Mölln 1992 sowie Solingen 1993 deutlich. Diese gesellschaftliche Stimmung wirkte auch in die Tagung „Marginale Brüche“ hinein.
Der Fokus der Tagung lag auf Praktiken der Macht, die intersektionale Verflechtungen von Rassismus, Antisemitismus und Sexismus hervorbringen. Das führte zu einer breitgefächerten inhaltlichen Ausrichtung und Einladung von Referent*innen; es handelte sich nicht um einen safe(r) space ausschließlich für rassistisch und antisemitisch diskriminierte Frauen*. Im Vorwort des Sammelbandes „AufBrüche“ ist zu lesen, dass eine weiße Literaturwissenschaftlerin (diese bleibt im Sammelband anonym) einen Vortrag über Leben und Werk der afro-deutschen Dichterin und Aktivistin May Ayim gehalten hat. May Ayim hatte sich im August 1996, im Jahr vor der Tagung, das Leben genommen. Dieser Vortrag wurde nach gemeinsamem Beschluss nicht in den Sammelband aufgenommen, weil er im Anschluss sehr kritisch rezipiert wurde und sich ein Konflikt unter den Teilnehmenden entwickelte. Die Texte von Ekpenyong Ani „Brüche“ und Cathy S. Gelbin „Die jüdische Thematik im (multi)kulturellen Diskurs der Bundesrepublik“ setzen sich anlässlich dieses Konflikts mit den Möglichkeiten und Grenzen von Bündnisbildung zwischen Frauen* auseinander, die auf unterschiedliche Weise marginalisiert werden.
Ekpenyong Ani stellt in ihrem Beitrag „Brüche“ das Verhältnis von Schwarzen, migrierten und jüdischen Frauen* zu weißen, christlich sozialisierten Frauen* in den Mittelpunkt. Die Tatsache, dass eine weiße Wissenschaftlerin so unmittelbar nach May Ayims Tod nicht nur über diese spricht, sondern ihr vielschichtiges literarisches Schaffen unzureichend und ausschließlich biografisch interpretiert, wertet Ani als hochproblematisch. Die Tagung, May Ayim gewidmet, zeigt die Grenzen eines Bündnisverständnisses auf, in dem Positionalität, ungleiche Machtverteilung und Privilegien aufeinandertreffen:
Und doch ahne ich, daß mir auch auf dieser Tagung die Besserwisserei und der ethnologische Blick begegnen werden. Meine Konsequenz ist der innere Rückzug, die Rücknahme der Bereitschaft, wirklich offen zu sein und mich bei dieser Tagung einzubringen. Aus meiner Sicht ist die Atmosphäre gespannt, und unter ein paar Schwarzen Frauen ist diese Spannung besonders deutlich zu spüren.9
Diese Anspannung liegt Ani zufolge darin begründet, dass die weiße Literaturwissenschaftlerin in ihrem Vortrag über Ayim von ihrem Werk auf ihre Person geschlossen, die Aussagekraft von Ayims Texten generalisiert und sie teilweise auf die gesamte afro-deutsche Community bezogen habe. Für Ani sei es fraglich, ob diese Literaturwissenschaftlerin oder andere weiße Literaturwissenschaftlerinnen eine derart defizitäre literaturwissenschaftliche Analyse auch bei Autor*innen wie Christa Wolf oder Günter Grass vor einem mehrheitlich weißen Publikum wagen würden. Dass eine weiße Wissenschaftlerin sich so früh nach Ayims Tod, als die Community sich noch mitten in ihrer Trauerarbeit befindet, unreflektiert mit ihr befasse, sei empörend. Die Wissenschaftlerin eigne sich May Ayim als ‚Thema‘ und als ‚Forschungsobjekt‘ an, ohne zu verstehen, welche zentrale Bedeutung diese für die afro-deutsche Community und die Schwarze Frauen*bewegung in Deutschland habe:
May Ayims Tod hat viel mit der rassistischen deutschen Gesellschaft zu tun, auch wenn es letztendlich eine ganze Reihe von Faktoren und zuletzt eine Entscheidung waren, die dazu führten. Wir, die zurückgelieben sind, mußten erkennen, daß Rassismus wirklich tötet.10
Ekpenyong Ani schlussfolgert, dass sie den Wunsch hatte, im Rahmen der Konferenz einen geschützteren Raum zu finden, in dem sich Schwarze, jüdische und migrierte Frauen* austauschen und Gemeinsamkeiten für künstlerische und politische Bündnisarbeit finden können. Sie habe sich einen Raum vorgestellt, in dem eigene wissenschaftliche Ansätze jenseits eurozentristischer Theoriebildungen diskutiert werden. Die Energien hätten sich aufeinander, statt gegeneinander richten sollen. Sie argumentiert, dass die Tagung sehr breit angelegt gewesen sei und deshalb in der Ausrichtung diffus wirkte. Die gleichzeitige Einbeziehung von dominanzgesellschaftlichen und marginalisierten Stimmen legten, ihr zufolge, den unbearbeiteten Rassismus innerhalb der Frauen*bewegung offen.
Cathy S. Gelbin knüpft in ihrem Beitrag „Die jüdische Thematik im (multi)kulturellen Diskurs der Bundesrepublik“ ebenfalls an die kontroverse Debatte in Folge des Vortrags über May Ayim an. Sie, die das Panel mit dem Ayim-Vortrag moderiert hatte, habe sich als Jüdin im Zuge der Diskussion in die Nähe der weiß positionierten Wissenschaftlerin gerückt gesehen. Seitdem sich der Diskurs über jüdische Perspektiven im Deutschland der 1990er-Jahre verändert und diese im Zuge einer geschichtlichen Aufarbeitung mehr ins Zentrum gerückt worden seien, würden diese von antirassistischen Bewegungen vorschnell in der Nähe dominanzgesellschaftlicher Positionen verortet:
In der Vergangenheit hatten sich diese Fragen in der politischen Zusammenarbeit zwischen jüdischen, migrierten und Schwarzen Frauen als so explosiv erwiesen, daß sie um des dünnen Zusammenhalts wegen nicht öffentlich diskutiert wurden beziehungsweise zum Eklat führten. Dies war auch auf der Kölner Tagung letzten Endes so, auf der die Frage danach, was ‚uns‘ eigentlich zusammenführt, in verdeckter Weise im Konflikt zwischen ‚marginalisierten‘ und der Domininanzkultur zugehörigen weißen Frauen ausgehandelt wurde.11
Sie spricht sich gegen eine Hierarchisierung von Ausgrenzungserfahrungen aus und betont, dass diese nicht notwendigerweise zu einer Sensibilität gegenüber dem eigenen diskriminierenden Verhalten führen.12Gelbins Erwartung für die Tagung war, ihre Erfahrungen aus Deutschland und den USA vergleichen und ihre akademischen mit ihren politischen Erfahrungen verknüpfen zu können. So wären viele angloamerikanische Theorien aus dem Bereich feministischer, lesbisch-schwuler und postkolonialer Theorien zu Identitäten und ihrer Funktion im politischen Prozess hilfreich gewesen. Mit diesen sei es möglich gewesen, eine kritische Sicht auf jene Identitätskonstrukte und Differenzierungen zu werfen, die nun eine Bündnisarbeit unmöglich zu machen schienen.13
Als Mitveranstalterin macht sie sich zudem erneut dafür stark, dass die Tagung allen – auch weißen Frauen* bzw. Künstlerinnen* und Wissenschaftlerinnen* – offenstand. Angehörige der Dominanzkultur könnten sich so intensiver mit einer sensiblen Herangehensweise in der Forschung und ihrer eigenen Positionierung und ihren Privilegien auseinandersetzen. Trotz des partiellen Scheiterns „eines Spagats zwischen Community, Bündnisarbeit und akademischem Anspruch“14und obwohl sich Gelbin als Jüdin in diesem Konflikt unsichtbar gemacht sieht, sei ein Festhalten an Bündnisarbeit wichtig, denn gerade Jüdinnen und Juden seien in Europa historisch lange von anderen Gruppen isoliert gewesen.
Was bleibt?
Die Konferenz „Marginale Brüche“ (1997) und der Tagungsband „AufBrüche“ (1999) zeigen eines deutlich: Die intersektionalen Gewalten innerhalb der Gesellschaft, aber auch der Widerstand gegen diese spiegeln sich in unseren Beziehungen und Bündnissen wider. Die Tagung war ein erster und damit naturgemäß von Erwartungen und Bestandsaufnahmen überladener Versuch, Bewegungsgeschichten, literaturwissenschaftliche Ansätze und künstlerische Praxis zusammenwachsen zu lassen. Es wurden Momente von Sensibilität und Solidarität ermöglicht. Die Tagung riss Wunden auf und machte Ungleichheit sichtbar. Trotzdem eröffnete sie auch den Raum für Debatten und Konflikte, wenn auch nicht in einem Maße, das für alle zufriedenstellend war. Damit, so schreibt Encarnación Gutiérrez Rodríguez, ist die Tagung in die lange Geschichte der politischen Bündnispolitiken von Schwarzen, migrierten, exilierten, jüdischen Frauen* sowie Roma und Sinti einzubetten.15Es bleiben einige Leerstellen. Die Tagung differenziert beispielsweise nicht zwischen migrierten und exilierten Frauen*, obwohl Exil und Migration jeweils sehr spezifische Auswirkungen auf Lebensverhältnisse, Aufenthaltsstatus und Prekarität haben können. Die Tagung bindet auch keine weiteren Diskriminierungsmerkmale außer Ethnisierung/Rassifizierung und Antisemitismus sowie Geschlecht ein. Damit werden Merkmale wie Klasse, Behinderung oder Generationenunterschiede bzw. Alter vernachlässigt. Außerdem fehlen Sinti und Roma – soweit ich das einsehen kann – bei den Wissenschaftlerinnen*, Künstlerinnen* und den literaturwissenschaftlichen Analysen. Dabei sind sie bei antirassistischen Kämpfen, Bewegungsgeschichten und Bündnispolitiken prominent aktiv.16Ihr Fehlen spricht für ihre systemische Marginalisierung im Literatur- und Wissenschaftsbetrieb. Im Bereich der Literatur ist beispielsweise an die deutsche Sintizza, Auschwitz-Überlebende und Autorin Philomena Franz zu denken.
Aus heutiger Perspektive gibt es viele Argumente für eine intersektionale, verflochtene Bündnispolitik. So zum Beispiel die zahlreichen strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wie Rassismus gegen Sinti und Roma und Antisemitismus oder antimuslimischer Rassismus in Deutschland entstanden sind, umgesetzt und instrumentalisiert wurden – und werden.17
Im Bereich der Literatur markieren Tagungspanels wie „Im Kaleidoskop der Identität“ oder Beiträge im Tagungsband wie der von Claudia Breger18einen Übergang zur zunehmenden Auseinandersetzung mit postmigrantischen19und transkulturellen Literaturen von den 2000ern bis zur Gegenwart. So setzt sich Olga Grjasnowa in ihrem Roman „Juli, August, September“ (2024) mit der Geschichte einer modernen jüdischen Familie und den Fragen nach jüdischer Identität in der Gegenwart auseinander. Fatma Aydemirs „Dschinns“ (2022) ist nicht nur ein Familienroman, der die Perspektive türkischer Gastarbeiter in Deutschland mit denen der zweiten und dritten Generation verbindet, sondern greift auch Fragen nach Zugehörigkeit und Heimat in mehrgenerationellen, (post)migrantischen Familien auf. Beide Romane arbeiten auf komplexe literarische Weise mit verschiedenen Zeitebenen und Perspektiven. Auch ein Roman wie Sharon Dodua Otoos „Adas Raum“ (2021) setzt sich mit der Verbundenheit verschiedener Zeitebenen auseinander, arbeitet Elemente des magischen Realismus und Afrofuturismus20ein, die die Vergangenheit befragen und neue Zukünfte imaginieren.
Als Analyseparadigma entwickeln diese Literaturen eine gegenhegemoniale Perspektive zu einem binär gedachten Literaturkanon, der zwischen ‚deutscher‘ und ‚migrantischer‘ Literatur zu differenzieren versucht, und tragen neue, gesellschaftskritische, transgenerationale und visionäre Perspektiven zu einer pluralen deutschsprachigen Literatur bei. Die Konferenz und der Tagungsband sind somit als Teil einer Geschichte von Bündnispolitiken und der Auseinandersetzung mit Literatur zu verstehen, die einer Praxis von „intersectional remembrance“21und einer diversitätsorientierten Erinnerung22verpflichtet sind.
Über die Autorin
Dr. Pegah Byroum-Wand war von 2021 bis 2024 wissenschaftliche Mitarbeiterin für Wissenschaftskommunikation und Partizipation im Verbundprojekt „Museums and Society – Mapping the Social" an der Technischen Universität Berlin. Hier hat sie einen Beirat, bestehend aus Berliner Aktivist*innen, aufgebaut und geleitet. Aus dieser Arbeit ist der von ihr herausgegebene Sammelband "MachtKritikKollaboration. Praxisreflexionen zwischen Aktivismus, Museum und Universität" hervorgegangen, der im März 2025 im Verlag Yılmaz-Günay erschienen ist. Weitere Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind Museen und Aktivismus, machtkritische Kollaborationen und Beiratsarbeit, diskriminierungskritische sowie postmigrantische Perspektiven. Zuvor hat sie unter anderem im Brücke-Museum Berlin und den Akademieprogrammen des Jüdischen Museums zu den Themen Diversität, Migration und Kolonialismus gearbeitet.
- 1An der Tagung haben auch nicht-binäre Personen teilgenommen, wie mein Mailverkehr vom 25.02.2025 mit einer Person aus dem Veranstaltungsteam, Peggy Piesche, belegt. Trotz nicht-binärer Selbstpositionierungen und eines offenen Verständnisses vom Begriff ‚Frau‘ auf der Tagung gab es den Diskurs darüber damals nicht. Deshalb spiegeln sich nicht-binäre Positionierungen nicht in der Schreibweise wider, etwa durch Nutzung eines Asterisks beim Begriff ‚Frau*‘.
Wenn im nachfolgenden der Tagungstitel, Artikel aus dem Tagungsband „AufBrüche“ (vgl. FN. 9) oder andere Quellen, in denen ‚Frau‘ als binärgeschlechtlicher Begriff genutzt wird, orientiert sich der vorliegende Text an der historischen Schreibweise ‚Frau/Frauen‘. Handelt es sich um meine eigenen Ausführungen, so wird die Schreibweise ‚Frau*/Frauen*‘ verwendet. Auf diese Weise soll der konstruktive Charakter markiert werden und verdeutlicht werden, dass diese Schreibweise alle Personen umfasst, die sich selbst als Frau*/Frauen* positionieren. Vgl.: Die Crux mit dem Sternchen – gendersensible Sichtbarkeit an der ASH Berlin: - 2Hito Steyerl. „Talking Back - Wi(e)dersprache. Ein Interview mit Peggy Piesche“. In: https://springerin.at/1998/1/talking-back-wiedersprache/ (11.10.2024).
- 3Zur Bandbreite der Tagungsthemen: https://springerin.at/1998/1/talking-back-wiedersprache/ (11.10.2024).
- 4Vgl Rösch, Heidi. „Zum Begriff der Migrationsliteratur." In: Grundthemen der Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik, herausgegeben von Christiane Lütge, 338–356, hier 339f. Berlin: De Gruyter, 2019.
- 5https://heimatkunde.boell.de/de/2009/02/18/betroffenheit-und-rhizom-literatur-und-literaturwissenschaft (15.10.2024); Durzak, Manfred, und Nilüfer Kuruyazici (Hrsg.). Die 'andere' Deutsche Literatur. Istanbuler Vorträge. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004. Interessant – und vernachlässigt im Rahmen der Konferenz und ihrer Rezeption – ist, dass DDR-Literatur ebenfalls als ‚die andere deutsche Literatur‘ bezeichnet wurde. Damit war zunächst allerdings nur die DDR-Literatur von weißen Deutschen gemeint. Vgl. Emmerich, Wolfgang. Die andere deutsche Literatur. Aufsätze zur Literatur aus der DDR. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1994.
- 6Vgl. https://heimatkunde.boell.de/de/2009/02/18/betroffenheit-und-rhizom-literatur-und-literaturwissenschaft (30.9.2024)
- 7Es gibt eine offene Debatte darüber, ob die Begriffe ‚Sinti‘ und ‚Roma‘ gegendert werden sollten. Die gegenderten Formen ‚Sinti*zze‘ und ‚Rom*nja‘ werden von Communityangehörigen mehrheitlich als dominanzgesellschaftliche Fremdbezeichnungen verstanden und abgelehnt, u.a. da sie mit der Grammatik vieler Romanes-Sprachvarietäten inkompatibel seien. Vgl. https://zentralrat.sintiundroma.de/mitgliederversammlung-beschliesst-papier-ueber-die-kontroverse-zum-gendern-der-selbstbezeichnung-sinti-und-roma/ (25.2.2025). Allerdings argumentieren queerfeministische Stimmen aus der Community dafür, die Bezeichnungen zu gendern. So sollen die spezifischen Kämpfe und sexistische Diskriminierungsformen sichtbar gemacht werden, ohne die heterogenen communityinternen Positionen gegeneinander auszuspielen oder Schreibweisen vorzugeben. Es wird außerdem betont, dass die Vorschläge zum Gendern aus der romani-queerfeministischen Bewegung selbst stammen und es sich nicht um dominanzgesellschaftlich aufoktroyierte Begriffe handelt. Vgl. https://www.romnja-power.de/eine-kleine-geschichte-von-romnja-und-sintizzeoder-woher-kam-das-gendern-von-hajdi-barz/ (25.3.2025). Der vorliegende Beitrag orientiert sich an der hier von Hajdi Barz diskutierten Verwendung der gegenderten Schreibweise. Damit möchte ich mich als Nichtangehörige, wie in Barz‘ Text thematisiert, mit den queerfeministischen Positionen unter Rom*nja und Sinti*zze solidarisieren.
- 8Vgl. Gutiérrez Rodríguez, Encarnación, und Pinar Tuzcu (Hrsg.). Migrantischer Feminismus in der Frauen:bewegung in Deutschland (1985-2000), S. 12. Münster: edition assemblage, 2021. Zum Überblick über die gesellschaftspolitischen Ereignisse, Gesetze und migrantisch-feministische Selbstorganisierung vgl. Gutiérrez Rodríguez, Encarnación. „Bündnispolitik, affektive (Ver-)Bindungen und kollektive Praxis. Migrantischer Feminismus zwischen rememory und Eingedenken." In: Migrantischer Feminismus in der Frauen:bewegung in Deutschland (1985-2000), herausgegeben von Encarnación Gutiérrez Rodríguez und Pinar Tuzcu, 32–66, hier 48–58. Münster: edition assemblage, 2021.
- 9Ani, Ekpenyong Ani. „Brüche“. In: AufBrüche: Kulturelle Produktionen von Migrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen in Deutschland. Herausgegeben von Cathy S. Gelbin, Kader Konuk und Peggy Piesche, 76 – 86, hier 78f. Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag, 1999.
- 10Ebd., S. 80.
- 11Vgl. Ebd., S. 87.
- 12Cathy S. Gelbin. „Die jüdische Thematik im (multi)kulturellen Diskurs der Bundesrepublik“. In: AufBrüche: Kulturelle Produktionen von Migrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen in Deutschland, herausgegeben von Cathy S. Gelbin, Kader Konuk, Peggy Piesche, S. 87–104, hier 104. Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag, 1999.
- 13Vgl. Ebd., S. 100.
- 14Vgl. Ebd., S. 101.
- 15Vgl. Gutiérrez Rodríguez. „Bündnispolitik“, S. 55.
- 16Vgl. Jonuz, Elizabetha. „Romnja – 'rassig' und 'rassistisch minderwertig'." In: Migrantischer Feminismus in der Frauen:bewegung in Deutschland (1985-2000), herausgegeben von Encarnación Gutiérrez Rodríguez und Pinar Tuzcu, 198–212. Münster: edition assemblage, 2021.
- 17Vgl. Attia, Iman. „Den Rassismus gibt es (nicht). Zum Verhältnis von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus." In: Fremdgemacht & reorientiert. Jüdisch-muslimische Verflechtungen, herausgegeben von Ozan Zakariya Keskinkılıç und Ármin Langer, 21–44. Berlin: Yilmaz-Günay Verlag, 2018.
- 18Breger, Claudia. „‘Meine Herren, spielt in meinem Gesicht ein Affe?‘ Strategien der Mimikry in Texten von Emine S. Özdamar und Yoko Tawada.“ In: AufBrüche: Kulturelle Produktionen von Migrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen in Deutschland., herausgegeben von Cathy S. Gelbin, Kader Konuk, und Peggy Piesche, 30–59, Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag, 1999.
- 19Zum Begriff vgl. Yildiz, Erol. „Postmigrantische Perspektiven. Aufbruch in eine neue Geschichtlichkeit.“ In: Nach der Migration. Postmigrantische Perspektiven jenseits der Parallelgesellschaft, herausgegeben von Erol Yildiz und Marc Hill, 19–36, hier 22, Bielefeld: Transcript Verlag 2014.
- 20Zum Begriff des Afrofuturismus vgl. Kelly, Natasha. „Afrofuturismus“. In: https://thefutureproject.de/content/afrofuturismus/?srsltid=AfmBOorI9OcNiV3xYSmkmkDCNWA4_UXabyO23Mrl9taYwS3kepw9Mp8Y (20.2.2025).
- 21Peggy Piesche. „Einleitung Oder: 1989 als Gesellschaftslabor“. In: Piesche, Peggy (Hrsg.). Labor 89. Intersektionale Bewegungsgeschichte*n aus West und Ost, 8, Berlin: Verlag Yilmaz-Günay, 2019. Als „intersectional remembrance“ wird hier ein inklusives und intersektionales Erinnern bezeichnet, in dem Communities of Color und weitere marginalisierte Gruppen ebenfalls eingeschlossen werden.
- 22Vgl. Rayanayagam, Iris (Hrsg.). Geteilte Geschichte_n – Plurale Solidaritäten. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2024. S. 10f.
Literatur
- Ackermann, Irmgard, und Harald Weinrich. Eine nicht nur deutsche Literatur: zur Standortbestimmung der „Ausländerliteratur". München: Piper Verlag, 1986.
- Ani, Ekpenyong. „Brüche“. In: AufBrüche: Kulturelle Produktionen von Migrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen in Deutschland. Herausgegeben von Cathy S. Gelbin, Kader Konuk und Peggy Piesche, 76 – 86. Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag, 1999.
- Attia, Iman. „Den Rassismus gibt es (nicht). Zum Verhältnis von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus." In: Fremdgemacht & reorientiert. Jüdisch-muslimische Verflechtungen, herausgegeben von Ozan Zakariya Keskinkılıç und Ármin Langer, 21–44. Berlin: Yilmaz-Günay Verlag, 2018.
- Barz, Hajdi. „Eine kleine Geschichte von ‚Rom*nja‘ und ‚Sinti*zze‘ oder Woher kam das Gendern.“: https://www.romnja-power.de/eine-kleine-geschichte-von-romnja-und-sintizzeoder-woher-kam-das-gendern-von-hajdi-barz/.
- Biondi, Franco, und Rafik Schami. „Literatur der Betroffenheit. Bemerkungen zur Gastarbeiterliteratur." In: Zu Hause in der Fremde. Ein bundesdeutsches Ausländer-Lesebuch, herausgegeben von Christian Schaffernicht, 2. Auflage. Reinbeck: Rohwolt-Verlag, 1984.
- Breger, Claudia. „‘Meine Herren, spielt in meinem Gesicht ein Affe?‘ Strategien der Mimikry in Texten von Emine S. Özdamar und Yoko Tawada.“ In: AufBrüche: Kulturelle Produktionen von Migrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen in Deutschland., herausgegeben von Cathy S. Gelbin, Kader Konuk, und Peggy Piesche, 30–59, Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag, 1999.
- Chiellino, Carmine. Interkulturelle Literatur in Deutschland – Ein Handbuch. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2000.
- Durzak, Manfred, und Nilüfer Kuruyazici (Hrsg.). Die 'andere' Deutsche Literatur. Istanbuler Vorträge. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004.
- Emmerich, Wolfgang. Die andere deutsche Literatur. Aufsätze zur Literatur aus der DDR. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1994.
- Gutiérrez Rodríguez, Encarnación und Pinar Tuzcu (Hrsg.). Migrantischer Feminismus in der Frauen:bewegung in Deutschland (1985-2000). Münster: edition assemblage, 2021.
- Gutiérrez Rodríguez, Encarnación. „Bündnispolitik, affektive (Ver-)Bindungen und kollektive Praxis. Migrantischer Feminismus zwischen rememory und Eingedenken." In: Migrantischer Feminismus in der Frauen:bewegung in Deutschland (1985-2000), herausgegeben von Encarnación Gutiérrez Rodríguez und Pinar Tuzcu, 32–66. Münster: edition assemblage, 2021.
- Gelbin, Cathy S., Kader Konuk, und Peggy Piesche (Hrsg.). AufBrüche: Kulturelle Produktionen von Migrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen in Deutschland. Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag, 1999.
- Gelbin, Cathy S. „Die jüdische Thematik im (multi)kulturellen Diskurs der Bundesrepublik“. In: AufBrüche: Kulturelle Produktionen von Migrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen in Deutschland, herausgegeben von Cathy S. Gelbin, Kader Konuk, Peggy Piesche, S. 87–104. Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag, 1999.
- Jonuz, Elizabetha. „Romnja – 'rassig' und 'rassistisch minderwertig'." In: Migrantischer Feminismus in der Frauen:bewegung in Deutschland (1985-2000), herausgegeben von Encarnación Gutiérrez Rodríguez und Pinar Tuzcu, 198–212. Münster: edition assemblage, 2021.
- Piesche, Peggy (Hrsg.). Labor 89. Intersektionale Bewegungsgeschichte*n aus West und Ost. Berlin: Verlag Yilmaz-Günay, 2019.
- Rayanayagam, Iris (Hrsg.). Geteilte Geschichte_n – Plurale Solidaritäten. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2024.
- Rösch, Heidi. Migrationsliteratur im interkulturellen Kontext: Eine didaktische Studie zur Literatur von Aras Oeren, Aysel Oezakin, Franco Biondi und Rafik Schami. Frankfurt am Main: Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 1992.
- Rösch, Heidi. „Zum Begriff der Migrationsliteratur." In: Grundthemen der Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik, herausgegeben von Christiane Lütge, 338–356. Berlin: De Gruyter, 2019.
- Steyerl, Hito. „Talking Back - Wi(e)dersprache. Ein Interview mit Peggy Piesche“. In: Springerin. Ränder – Formate – Verortung. Heft 1 (1998): https://springerin.at/1998/1/talking-back-wiedersprache/.
- Şölçün, Sargut. Sein und Nichtsein: Zur Literatur in der multikulturellen Gesellschaft. Bielefeld: Aisthesis-Verlag, 1992.
- Yildiz, Erol. „Postmigrantische Perspektiven. Aufbruch in eine neue Geschichtlichkeit.“ In: Nach der Migration. Postmigrantische Perspektiven jenseits der Parallelgesellschaft, herausgegeben von Erol Yildiz und Marc Hill, 19–36, hier 22, Bielefeld: Transcript Verlag 2014.
- Verband Deutscher Sinti und Roma - Landesverband Rheinland-Pfalz. „Mitgliederversammlung beschließt Papier über die Kontroverse zum Gendern der Selbstbezeichnung Sinti und Roma“: https://zentralrat.sintiundroma.de/mitgliederversammlung-beschliesst-papier-ueber-die-kontroverse-zum-gendern-der-selbstbezeichnung-sinti-und-roma/.