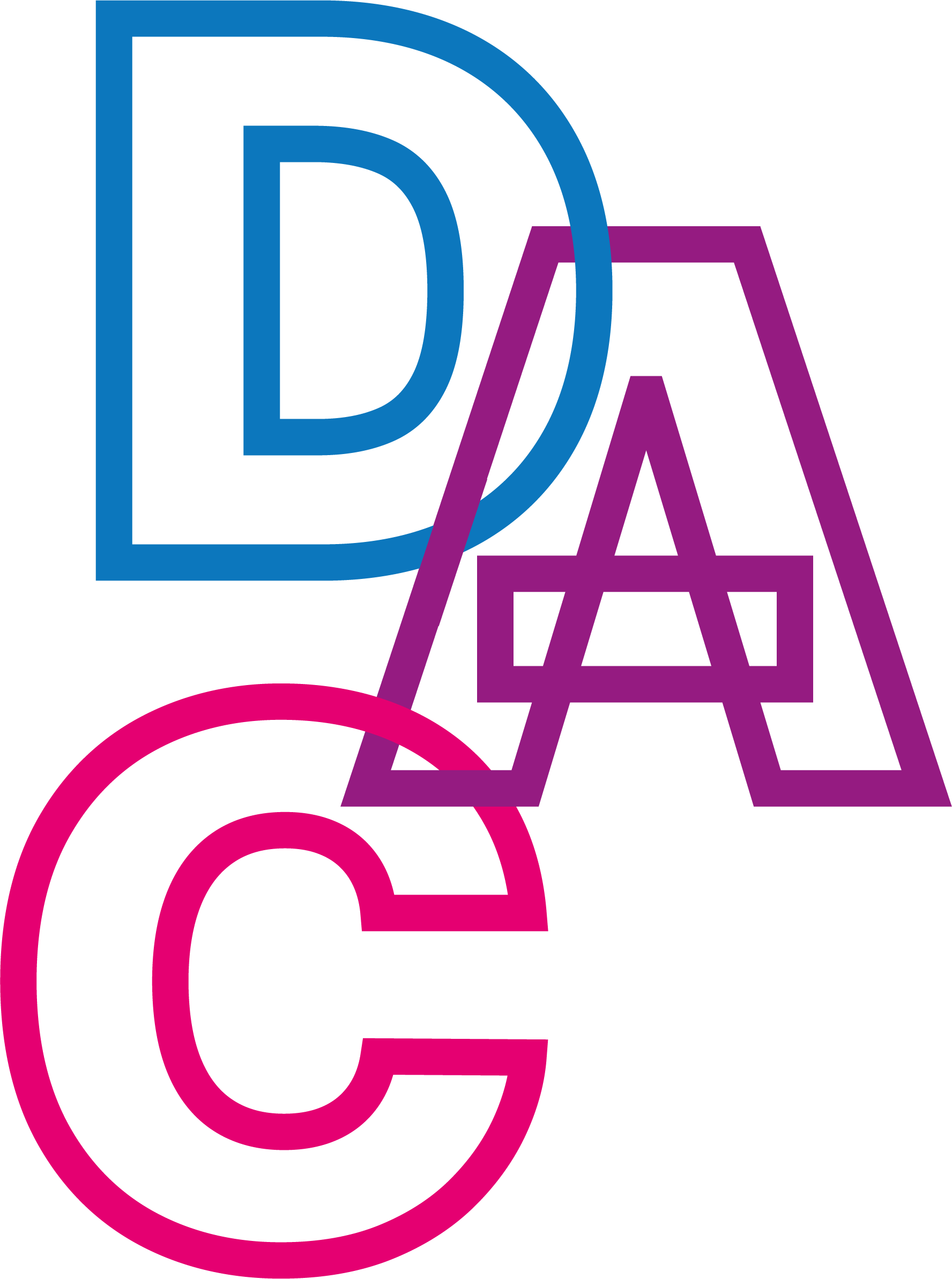Behinderung ausstellen
„Der (im-)perfekte Mensch“ im Deutschen Hygiene-Museum Dresden
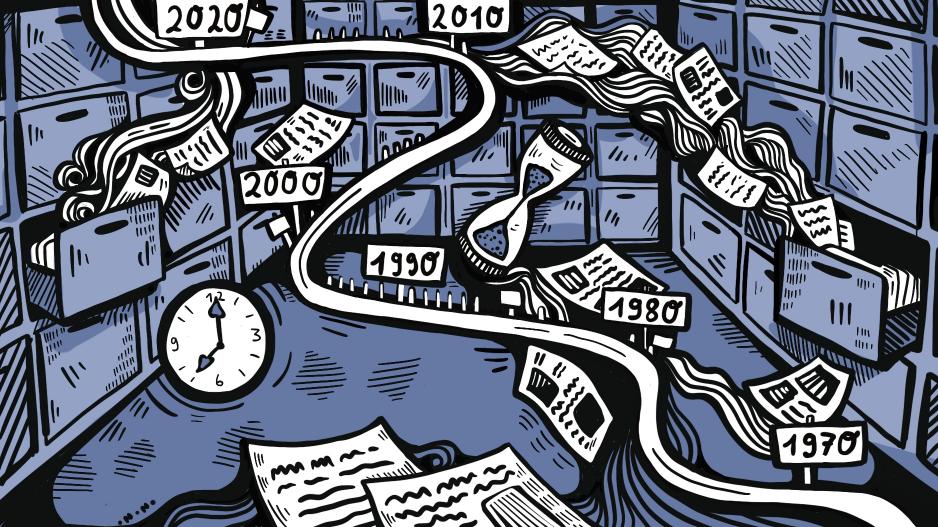
Text: Dirk Sorge
Wie kann das Thema Behinderung im Museum ausgestellt werden? Wenn wir diese Frage heute stellen, denken wir schnell an ethische und (kultur-)politische Aspekte, z.B. an Machtstrukturen und Deutungshoheit im Kulturbereich. Wer darf was wie ausstellen? Die Frage hat aber auch eine andere Ebene, eine museologische: Wie lässt sich Behinderung überhaupt anhand von Objekten in einem Museumskontext zeigen? Behinderung ist kein Ding, kein Artefakt und auch kein natürlicher Gegenstand. Ein Museum kann Dinosaurierknochen ausstellen oder Ölgemälde oder Flugzeuge. Aber Behinderung ist kein solches Ding unter Dingen. Behinderung entsteht aus der Wechselwirkung von Menschen mit Beeinträchtigungen und den Barrieren in der Gesellschaft und der (gebauten) Umwelt. Das betrifft nicht nur Gebäude, Technik und Gebrauchsgegenstände, sondern auch alle Formen von Kommunikation und Verhaltenskonventionen. Seit dem Jahr 2009, als die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft getreten ist, hat sich dieses soziale Modell von Behinderung mehr und mehr durchgesetzt oder ist zumindest in weiten Kreisen bekannt. Vor einem Vierteljahrhundert, als das Deutsche Hygiene-Museum Dresden (DHMD) eine Ausstellung zu Behinderung kuratieren wollte, war das noch keineswegs der Fall. Wie also stellt man eine Wechselwirkung aus?
Vom 20. Dezember 2000 bis zum 12. August 2001 zeigte das DHMD die Sonderausstellung „Der (im-)perfekte Mensch. Vom Recht auf Unvollkommenheit“. Anschließend wanderte die Ausstellung nach Berlin in den Gropius Bau.1In der Ausstellung wurde das Thema Behinderung anhand der Dichotomie perfekt – imperfekt oder „normal“ – „anormal“ verhandelt und diese Zweiteilung sollte dabei gleichzeitig hinterfragt werden. Im Vorwort des Ausstellungskatalogs wird das Ziel klar benannt: „Indem sie über die gegenwärtig bestehenden Grenzen von normal und anormal, perfekt und (im-)perfekt nachdenkt, soll diese Ausstellung Wege und Möglichkeiten öffnen, jene Grenzen zu verrücken und (gelegentlich) ganz außer Kraft zu setzen.“2Warum dies nur „gelegentlich“ passieren soll, wird nicht begründet. Umfassende Inklusion war damals noch nicht einmal gedanklich möglich.
Der Kooperationspartner des DHMD war die Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V., die sich erst im März 2000 umbenannt hatte. Sie trug bis dahin den Namen „Aktion Sorgenkind“. So kann die Ausstellung auch als Versuch verstanden werden, sich ein neues zeitgemäßeres Image zu geben und die eigene problematische Vergangenheit hinter sich zulassen. Das wird in einem wissenschaftlichen Sammelband, der das Projekt begleitet, sogar explizit erwähnt: „Beide Partner verbanden mit dem Projekt auch die kritische Reflexion ihrer eigenen Vergangenheit: Das Deutsche Hygiene-Museum propagierte während des Nationalsozialismus die NS-Rassenideologie, die Aktion Mensch prägte in den sechziger und siebziger Jahren als ‚Aktion Sorgenkind‘ stereotype Wahrnehmungen von Menschen mit Behinderung, die zum Teil ins kollektive Bildgedächtnis eingegangen sind.“3Die problematischen Stereotype der Aktion Sorgenkind werden in der Ausstellung z.B. anhand von Fernsehwerbespots gezeigt, in denen behinderte Kinder auf ihre Defizite reduziert werden und Mitleid erregen sollen. Dies war die klassische Opferdarstellung, gegen die sich die Ausstellung u.a. wendete. Das DHMD dokumentierte seine belastete ideologische Vergangenheit durch Verweise auf Ausstellungen und andere Veranstaltungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in denen es um die Rolle der Mutter ging, um gesunde Kinder frei von „Erbkrankheiten“ und um sogenannte „Rassenhygiene“.
Nicht nur inhaltlich sollte die Ausstellung im Jahr 2000 ein Meilenstein sein, sondern auch in der Form der Gestaltung. So lobt Dieter Stolte, der Vorstandsvorsitzende der Aktion Mensch und Intendant des ZDF die „nahezu barrierefreie Gestaltung“4der Ausstellung. Ob dieser hohe Anspruch tatsächlich eingelöst wurde, lässt sich leider rückblickend nicht mehr nachvollziehen. Im Katalog der Ausstellung sind die Ausstellungsräume nur als Entwurfsmodelle abgebildet. Es gibt im Text Hinweise auf Videos in Deutscher Gebärdensprache und Texte in Brailleschrift, was in Museen in Deutschland bis heute nicht selbstverständlich ist, aber eben nur Teilaspekte von Barrierefreiheit darstellt. Im Kulturbereich wurde die Ausstellung jedenfalls auch viele Jahre später immer wieder als Best-Practice Beispiel für Barrierefreiheit und Inklusion genannt.
Da Behinderung selbst nicht ausgestellt werden kann, musste die Ausstellung Stellvertreterobjekte finden: Häufig sind es Abbildungen von behinderten Personen (Bilder und Figuren von kleinwüchsigen Menschen an europäischen Höfen, Darstellungen von Kriegsversehrten) oder Hilfsmittel und „Werkzeuge“ für medizinische Eingriffe (Prothesen, Orthesen, Zwangsjacke, Zwangsstuhl). Auch medizin-historische Feuchtpräparate, die sogenannte „Missbildungen“ (besser gesagt: Menschen, die während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt gestorben sind) zeigen, waren Teil der Schau. Wenn Menschen aus der Vergangenheit thematisiert wurden, waren es meistens prominente oder mächtige Einzelpersonen (Präsident Roosevelt im Rollstuhl, Beethovens Hörrohre) oder es waren „Typen“ also anonyme Platzhalter wie „der Kriegsbeschädigte“ oder „die Irre“ ohne individuelle Eigenschaften. Das ist ein systematisches Problem von musealen Sammlungen und Archiven insgesamt: Nicht-prominente Menschen wurden in der Regel nicht abgebildet und autobiographische Dokumente und Zeugnisse von ihnen wurden nicht gesammelt. Dadurch wissen wir über die Selbstwahrnehmung und das konkrete Alltagsleben behinderter Menschen aus vergangenen Jahrhunderten sehr wenig und können es auch nicht ausstellen.
Behinderung lässt sich aber nicht nur anhand von Objekten oder Einzelpersonen thematisieren, sondern auch anhand von Strukturen bzw. Institutionen und deren Geschichte. Einen besonderen Platz nimmt hier „die Anstalt“ ein. Sie fungiert als inszenierendes Mittel der Ausstellungsarchitektur, da eingebaute Wände durch Grenzziehung ein Innen und Außen markieren. Außen die „Normalen“, die durch Luken die „Anormalen“ im Inneren beobachten. Die Anstalt kann ein konkreter Ort sein (Gefängnis, Klinik, Armenhaus, Altenheim, Kinderheim), sie kann aber auch als Metapher für den Wunsch nach Kontrolle und Ordnung verstanden werden. So wurden in der Ausstellung verschiedene Typen von Anstalten selbst historisch eingeordnet und ihre Funktionen wie Normieren, Normalisieren und Auslöschen behandelt. Anhand von historischen Fotos und Filmaufnahmen wurde das Leben in Heil- und Pflegeanstalten gezeigt, in denen wenig Platz für Individualität war. Auch die systematische Ermordung und Zwangssterilisation von hunderttausenden behinderten Menschen während des Nationalsozialismus waren nur durch die Organisation und Logistik der Anstalten möglich. Am Beispiel der Anstalt lässt sich auch das oben genannte Problem veranschaulichen, wenn es darum geht, konkrete Lebensrealitäten von Menschen darzustellen. In Anstalten verlieren Menschen ihre Individualität und werden zu Nummern oder Fällen: „So notwendig es wäre, die ‚Enteignung‘ auszustellen, so unmöglich ist dieses Anliegen: Ihr Inhalt wäre gerade das, was nicht vorhanden ist und auch nicht vorhanden gewesen ist, das Persönliche. Verwaltungsakten hingegen existieren für jeden einzelnen Menschen, der freilich nur ein ‚Fall‘ ist.“5Zu den wenigen historischen, persönlichen Dokumenten, in denen behinderte Menschen selbst als Subjekte zu Wort kommen, gehören Briefe, die Insassen von Anstalten an ihre Angehörigen geschrieben haben. Diese wurden von den Anstalten einbehalten und haben die Adressat*innen nie erreicht. Stattdessen wurden sie zur Dokumentation der Krankheit oder Behinderung gesammelt. In den Sammlungen von psychiatrischen Anstalten (bzw. später psychiatrische Kliniken) befinden sich außerdem Kunstwerke von Patient*innen oder Insassen. Auch diese wurden in der Ausstellung im DHMD gezeigt und als Kunstwerke von sogenannten Außenseitern (Stichwort Outsider Art) bezeichnet. Viele der Kunstwerke bestehen aus Abfallmaterial, was darauf hinweist, dass die Tätigkeit der Insassen nicht als professionelle künstlerische Arbeit anerkannt, unterstützt und wertgeschätzt wurde. Wiederkehrendes Motiv ist das Fliegen (bzw. Fliehen aus der Anstalt). Die gezeigten künstlerischen Arbeiten der sogenannten Außenseiter stammten von: Adolf Wölfli, Maria Rudbeck, Gustav Mesmer, Karl Hans Janke, Paul Schlotterbeck, André Robillard, Josef Breidenbach.
Da die Kunstwerke der Öffentlichkeit aber in der Regel erst nach dem Tod oder in Abwesenheit der Künstler*innen gezeigt werden, kann man sich fragen, inwiefern hier die Grenzen der Kunst verändert werden, wie es im Katalog behauptet wird.6Wenn man Kunst als System versteht und nicht nur als die Summe der Kunstwerke, kann man zu einem anderen Schluss kommen: Indem die Künstler*innen als Outsider markiert werden, vermeidet das Kunstsystem gerade die Veränderung. Die Outsider werden punktuell reingelassen, wenn es passt, und wieder ausgestoßen, wenn es zu anstrengend oder unangenehm wird. Weder die Kunstproduktion noch die Ausstellungspraxis ändert sich dadurch. Der nicht-behinderte Kunstbetrieb bleibt so wie er ist und nicht-behindertes Klinikpersonal entscheidet, welche Kunstwerke in einer separierten Nische gelegentlich gezeigt werden.7Außenseiterkünstler*innen wurden und werden vom regulären Kulturbereich systematisch ferngehalten und treten dadurch nicht als autonome Subjekte in Erscheinung. Passend dazu wird im Katalog erwähnt, dass das Blaumeier-Atelier aus Bremen eine künstlerische Installation zur Ausstellung beigetragen hat. Leider ist sie im Katalog weder abgebildet noch beschrieben. Fast noch schlimmer: Die Künstler*innen werden nicht namentlich genannt, sondern sind pauschal „das Atelier“, als wären sie eine homogene Masse. Im Gegensatz dazu wird die akademisch ausgebildete Künstlerin Enna Kruse-Kim, die in der Ausstellung ebenfalls mit einer Installation vertreten war, namentlich genannt und bei den Biografien der beteiligten Wissenschaftler*innen und Autor*innen wird sie selbstverständlich mitaufgeführt. Diese Kritik mag kleinlich erscheinen, aber solche Details können darüber entscheiden, wer eine Karriere als Einzelkünstler*in außerhalb der „Anstalt“ hat und wer nicht. Die (in der Regel nicht-behinderten) Leitungen von Anstalten und anderen Einrichtungen sind Gatekeeper im wörtlichen Sinn: Sie bewachen die Tore der Institution und entscheiden, wer rein und raus kommt.
Im Kontext der Anstalt wurde auch das absurde System der Werkstätten für behinderte Menschen (damals noch „Werkstätten für Behinderte“) kritisiert. Einerseits halten diese Institutionen behinderte Menschen in exkludierenden Räumen vom ersten Arbeitsmarkt und vom Rest der Gesellschaft fern, andererseits sind sie dennoch der profitorientierten Logik des Marktes unterworfen. Diese Lose-Lose-Situation für die behinderten Beschäftigen wird in der Ausstellung mit der Frage zugespitzt: „Würden Sie für 150 Mark im Monat arbeiten?“8In dieser Diskussion sind wir in den letzten 25 Jahren kaum vorangekommen.
Da der Blick in die Geschichte wenig Erkenntnis über die Gedanken, Gefühle und das Alltagsleben von nicht-prominenten Individuen zulässt, sind zeitgenössische Positionen umso wichtiger. Der Einsatz von Audio- und Videoinstallationen in der Ausstellung ließ zeitgenössische behinderte Menschen in Form von Interviews zu Wort kommen. Sie sprachen über ihre Lebensrealität, über Barrieren und ihren Umgang mit der Behinderung. Manches, was sie sagen, ist schlecht gealtert und verrät viel über den verinnerlichten Ableismus. Die Zitate und Texte im Katalog vermitteln das Bild einer Zeit, die einerseits noch stark durch das medizinische Modell von Behinderung geprägt ist und andererseits schon weiß, dass die Barrieren in der Umwelt abgebaut werden müssen. Das medizinische Modell ist deutlich erkennbar, wenn in einer Abteilung der Ausstellung anhand der Kategorien „Sehen“, „Hören“, „Bewegen“ und „Verstehen“ sehr klassisch durchdekliniert wird, was nicht-behinderte Menschen können und behinderte Menschen nicht können. Es ist ein defizitorientierter Ansatz, der – im besten Fall – durch Kommentare der zeitgenössischen behinderten Menschen unterlaufen und durchbrochen wird. Echtes Empowerment ist aber schwierig, wenn zunächst ableistische Narrative abgeräumt werden müssen.
Obwohl der Mensch als biologisches Wesen immer wieder im Fokus stand, wollte die Ausstellung auch die soziale und kulturelle Seite und die „Gemachtheit“ von Normen, Idealen und der Grenze von behindert und nicht-behindert thematisieren. Für den historischen Kontext der Ausstellung ist wichtig, sich daran zu erinnern, welche medizinischen und wissenschaftlichen Diskussionen in den 1990er Jahre stattfanden. Es war das goldene Zeitalter der Gentechnik und der Bioethik. Die realen Fortschritte und erdachten Möglichkeiten der Molekularbiologie wurden in Feuilletons breit debattiert. Die „Hoffnung“ auf die Perfektionierung des Menschen frei von Krankheit, „Leid“ und Behinderung schien zum Greifen nahe. Obwohl das schon damals eine Illusion war, gab es doch eine unterschwellige Bedrohung für behinderte Menschen, die unter der Zielvorgabe einer neuen Eugenik nicht mehr Teil der Menschheit wären. Wenn genetische „Defekte“ nicht behoben werden können, sollte durch gentechnische Analysen behindertes Leben vor der Geburt erkannt und frühzeitig verhindert werden. Die Ideologie des Nationalsozialismus kehrte unter dem Deckmantel von Kosten-Nutzen-Abwägungen und der vermeintlichen Reduktion individuellen Leids auf Seiten werdender Eltern zurück bzw. war nie wirklich überwunden. Die Frage nach dem „lebenswerten Leben“ stellte sich zwangsläufig, um Maßnahmen wie Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsabbrüche nach der 12. Woche ethisch zu rechtfertigen. Diese komplexen Diskussionen muss man sich vergegenwärtigen, um zu verstehen, wogegen sich die Ausstellung „Der (im-)perfekte Mensch“ wendet und warum sie so relevant war. Es war keine Ausstellung über die Geschichte von Behinderung, sondern sie sollte zeigen, wie die Idee von Normalität medizinisch, medial und kulturell konstruiert wird. Diese Konstruktion kann dann im schlimmsten Fall politisch instrumentalisiert werden, um behindertes Leben zu verhindern oder zu delegitimieren. Die Ausstellung leistete damit einen wichtigen Beitrag zu bioethischen Debatten. Während in Feuilleton und Wissenschaft vor allem über das behinderte Leben spekuliert wurde, kamen in der Ausstellung Menschen mit Behinderung direkt zu Wort und konnten eine große Öffentlichkeit erreichen.9Dadurch wurde ein theoretisches Argument praktisch veranschaulicht: Es ist nicht nur anmaßend, sondern auch sinnlos, über den Wert eines Lebens zu spekulieren, das man selbst nicht kennt. Das ist ein Verdienst, das man der Ausstellung – bei aller Kritik – nicht absprechen kann. Auch einige Akteur*innen der deutschsprachigen Behindertenrechtsbewegung bekamen in der Ausstellung Raum und wurden als politisch aktive Subjekte gezeigt. Beispielsweise Gusti Steiner, der als Vertreter der Krüppelbewegung (Selbstbezeichnung) 1981 die Feierlichkeiten zum „Internationalen Jahr der Behinderten“ als Seifenoper bezeichnete. Er besetzte mit anderen Aktivist*innen die Dortmunder Westfalenhalle, um gegen Ausgrenzung und Fremdbestimmung durch Nicht-Behinderte zu protestieren. Oder Franz Christoph, der im selben Jahr den Bundespräsidenten Karl Carstens auf einer Reha-Messe in Düsseldorf mit einer Krücke schlug. Der Angriff blieb ohne rechtliche Konsequenzen, was performativ bewies, dass behinderte Menschen nicht ernst genommen werden. Auch für den akademischen Bereich war die Ausstellung im DHMD eine wichtige Impulsgeberin. Bei einer begleitenden Konferenz im Juli 2001 waren Rosemarie Garland Thomson, Sharon Snyder und David T. Mitchell als Vertreter*innen der Disability Studies eingeladen – einer Disziplin, die in Deutschland zu der Zeit noch wenig bekannt war.
Die Ausstellung veranschaulicht, dass die Kategorien perfekt – imperfekt sich gegenseitig brauchen und wechselseitig aufeinander verweisen, da sie getrennt voneinander gar keinen Inhalt haben. Oder anders gesagt: Behindert ist der Mensch, der nicht nicht-behindert ist. Nicht-behindert ist der, der nicht behindert ist. Scheinbar eine Tautologie (also eine wahre Aussage, die aber keinen Erkenntnisgewinn bringt), aber im realen Leben wird diese Grenze durch Praktiken und Konventionen hervorgebracht und konstruiert. Konstruktion meint nicht, dass etwas „bloß erfunden und deshalb nicht real“ ist, sondern es ist gerade deshalb real, weil es konstruiert wurde. Das System der Förderschulen und Behindertenwerkstätten ist gerade deshalb real, weil es konstruiert wurde. Nichts daran ist „natürlich“ oder „normal“.
Über den Autor
Dirk Sorge studierte Bildende Kunst an der Universität der Künste Berlin und Philosophie an der Technischen Universität Berlin. Als Bildender Künstler beschäftigt er sich mit den Themen Technisierung, Ableismus und Irrationalität. Er arbeitet seit über 10 Jahren als Kulturvermittler und Berater zu Fragen der Inklusion und Barrierefreiheit für verschiedene Museen in Berlin und Sachsen. Dirk Sorge hat im Jahr 2021 die Ausstellung „Norm und Form. Design für alle?“ im bauhaus temporary co-kuratiert und von 2014 bis 2016 an einem Forschungsprojekt zu Prothetik in Kooperation mit dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden gearbeitet.
- 1Die Ausstellung habe ich nicht gesehen. Oder ich erinnere mich nicht mehr. Ich war damals ein Teenager und zu sehr damit beschäftigt, meine eigene Behinderung zu verstecken.
- 2Stiftung Deutsches Hygiene-Museum Dresden und Aktion Mensch e.V. (Hrsg.): Der (im-)perfekte Mensch: vom Recht auf Unvollkommenheit. Ostfildern-Ruit: 2001, S. 7.
- 3Petra Lutz, Thomas Macho, Gisela Staupe und Heike Zirden (Hrsg.): Der (im-)perfekte Mensch: Metamorphosen von Normalität und Abweichung. Köln: 2003, S. 12.
- 4Der (im-)perfekte Mensch: vom Recht auf Unvollkommenheit, S. 9.
- 5Ebd., S. 204.
- 6Vgl. ebd., S. 239.
- 7Auch heute werden behinderte Künstler*innen gerne „dazugeholt“, wenn Kultureinrichtungen zeigen wollen, dass sie inklusiv sind. Solange das aber nur in Sonderausstellungen und temporären Projekten passiert, ändert sich strukturell nicht viel.
- 8Ebd., S. 205.
- 9Schon einen Monat vor Ausstellungsende gab es 135.000 Besucher*innen, was ein Rekord für Sonderausstellungen im DHMD war. Vgl. https://taz.de/!1163083/, abgerufen am 19.12.2024.