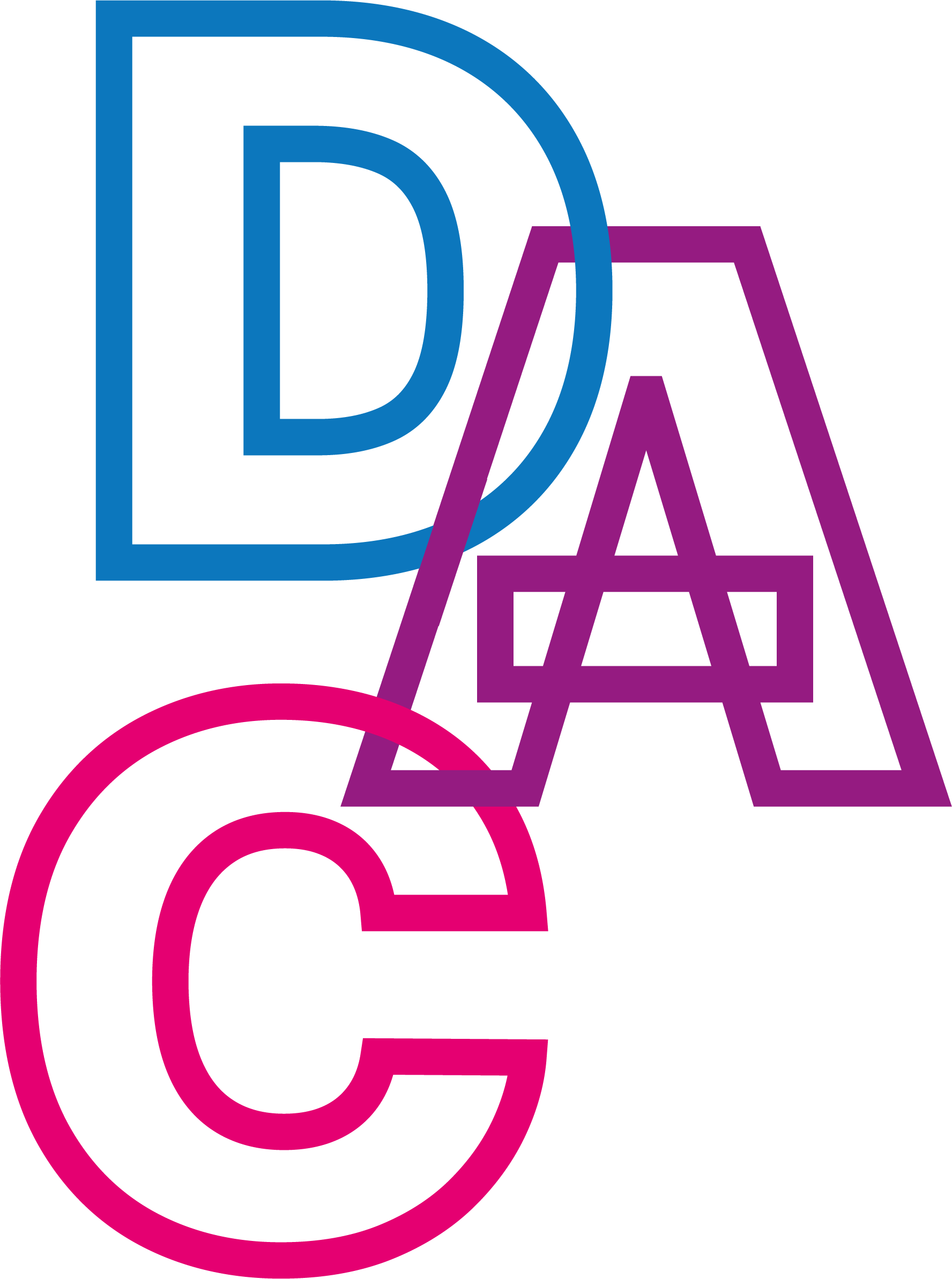Sprache vereinfachen
Tipps und Tricks, damit eure Inhalte (noch) verständlicher werden

Kennt ihr das? Ihr sitzt bei einer Veranstaltung oder lest ein Formular und fragt euch: Um was geht’s jetzt eigentlich? Oft wird im Kunst- und Kulturbereich sehr komplizierte Sprache benutzt. Das ist nicht nur bei komplexen Themen so. Auch „einfache“ Ideen werden oft in akademischer Sprache verpackt. Es gibt einige gute Tipps, wie ihr eure eigenen Inhalte verständlicher und lebendiger machen könnt.
Wichtig ist, dass ihr den Unterschied zwischen „Leichter Sprache“ und anderen Formen von vereinfachter Sprache kennt. Die verschiedenen Begriffe werden oft miteinander verwechselt. Leichte Sprache hat feste Regeln für Grammatik, Satzbau und Gestaltung. Diese Sprachform richtet sich vor allem an Menschen mit Lernschwierigkeiten. Deshalb dürfen Texte nur als Leichte Sprache bezeichnet werden, wenn Menschen mit Lernschwierigkeiten sie geprüft haben. Wer Texte in Leichter Sprache schreibt, muss dafür gut ausgebildet sein. Hier findet ihr weitere Infos zu Leichter Sprache.
Andere Formen vereinfachter Sprache haben keine festen Regeln. Sie geben Empfehlungen, wie ihr Texte verständlich formulieren könnt. Hier haben wir viele dieser Empfehlungen zusammengefasst. Mit diesen Tricks könnt ihr so schreiben und sprechen, dass mehr Menschen eure Inhalte verstehen.
Grammatik und Stil
Sätze
Benutzt vor allem Hauptsätze und vermeidet Schachtelsätze.
Kurze und klare Sätze:
- max. 15-20 Wörter
- eine Aussage pro Satz
- lange Sätze in mehrere Sätze aufteilen
- Einschübe: max. 12 Silben
- Subjekt und Prädikat nahe beieinander lassen
- zusammengehörige Verben nahe beieinander lassen
Beispiel:
Das Konzept „Schachtelige Sprache“, das sich von der einfachen Sprache unterscheidet, wurde an der Universität XYZ gegründet, und zwar von A.B.C. im Jahr XXXX, mit dem Ziel, Sprache komplizierter zu machen, als sie eigentlich sein müsste.
Das Konzept „Schachtelige Sprache“ unterscheidet sich von der einfachen Sprache. Es wurde von A.B.C. im Jahr XXXX an der Universität XYZ gegründet. Das Ziel dabei war, Sprache komplizierter zu machen, als sie eigentlich sein müsste“.
Wortwahl
Benutzt alltägliche und aktive Sprache. Vermeidet Fachbegriffe oder komplizierte Ausdrücke.
- einfache, bekannte, möglichst kurze Worte: Beispiele: „Verneinung“ statt „Negation“; „Geld“ statt „finanzielle Mittel“; „Wandel“ statt „Paradigmenwechsel“
- konkrete, anschauliche Wörter: Wörter, die konkrete Bilder erzeugen oder unsere Sinne ansprechen (Riechen, Fühlen, Sehen, Schmecken). Beispiele: „Platzregen“ statt „ergiebige Niederschläge“
- abstrakte Begriffe ohne Fülle vermeiden: z.B. Bereich, Raum, Ebene, Gebiet. Beispiele: „in der Kulturellen Bildung“ statt „im Bereich der Kulturellen Bildung; „Personal“ statt „Personalebene“
- simple und möglichst „handelnde“ Verben: Beispiele: machen, schaffen, wollen, können, mögen
- Nominalstil vermeiden: Benutzt Verben statt Nomen oder Substantivierungen. Substantivierungen sind groß geschriebene Wörter, die z.B. auf -ion, -keit, -ung, -heit, -schaft oder -en enden. Diese Endungen werden verwendet, um aus Verben, Adjektiven oder anderen Wortarten ein Substantiv zu bilden. Beispiel: „Wir sprechen den dringenden Ratschlag zur Vereinfachung eurer Texte durch Formulierungen ohne Nominalstil aus.“ à „Wir raten euch dringend, eure Texte zu vereinfachen, indem ihr Nominalstil vermeidet.“
- aktive Sprache: Das Passiv verheimlicht die handelnde Person (das Subjekt!). Es macht Sätze abstrakt und unkonkret. Bei der aktiven Sprache taucht dagegen immer das Subjekt auf. Das macht euren Text lebendiger und greifbarer. Am besten benennt ihr das Subjekt immer am Satzanfang. Beispiel: Es wurde eine Symphonie, die eigens für diesen Anlass komponiert worden war, gespielt. (passiv) → Das Orchester spielte eine Symphonie, welche die Komponistin eigens für diesen Anlass komponiert hatte. (aktiv)
- Weniger bzw. spezifische Adjektive: Setze Adjektive nur ein, wenn sie wirklich zum Verständnis beitragen. Vermeide unspezifische Adjektive wie z.B. „interessant“. Wähle beschreibende statt bewertender Adjektive. Beispiel: bunt bestickter Schal statt schöner Schal
- Verzichtet auf Ironie, Verneinungen, komplizierte Metaphern
- Bejahen statt Verneinen: Oft nutzen wir Verneinungen, um etwas indirekt zu kommunizieren. Dabei können schnell Missverständnisse entstehen. Allerdings geht es beim Bejahen und Verneinen auch um inhaltliche Nuancen. So weicht ein Verneinen manchmal inhaltlich von einem Bejahen ab. Beim vereinfachten Schreiben gehen die Nuancen gegebenenfalls verloren. Wäge hier ab, ob du vereinfachen möchtest. Beispiel: „Bitte vermeide keine Verben.“ wird zu „Nutze bitte Verben.“ Beispiel mit inhaltlichen Nuancen: „Der Film war nicht schlecht.“ wird zu „Der Film war gut.“ (Dass der Film nicht schlecht war, muss nicht unbedingt bedeuten, dass der Film gut war.)
- Beispiele und Bilder: Mit Grafiken, Bildern oder Illustrationen könnt ihr Informationen visuell unterstützen. Bitte macht visuelle Materialien auch für Menschen mit Sehbehinderungen zugänglich. Unsere Tipps hierzu findet ihr demnächst hier.
- Wiederholungen statt Synonyme: Traut euch, Wörter zu wiederholen, anstatt immer neue, gleichbedeutende Wörter zu verwenden. Vor allem gesprochene Inhalte sind leichter zu verstehen, wenn du gleiche Wörter benutzt.
- überflüssige Wörter streichen: Viele überflüssige Wörter machen die Aussage komplizierter, als sie ist. Beispiel: „Die durchaus doch recht beeindruckende und relativ betrachtet gar nicht so unerhebliche Tatsache ist, dass ich persönlich dabei war, als das durchaus signifikante und gewissermaßen doch nicht unwichtige Ereignis stattgefunden hat.“
- Abkürzungen erklären
Inhalt und Aufbau
Vor dem Schreiben
Es gibt einige grundlegende Fragen, die ihr euch vor dem konkreten Formulieren eines Textes oder Vortrages stellen könnt. Damit fällt das Schreiben oft leichter. Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass euer Text auch für andere verständlicher wird.
Wenn ihr z.B. eine Veranstaltung planen möchtet, ist es auch wichtig, abzuwägen: Wie stark vereinfache ich die Ankündigung, wenn bei der Veranstaltung beispielsweise ein schwer verständlicher literarischer Text vorgelesen wird? Wichtig ist, transparent zu machen, wie verständlich die Veranstaltung ist. Und genau zu überlegen: Welche Texte müssen in schwieriger Sprache formuliert sein? Was kann vereinfacht werden? Wenn ihr die Veranstaltung leicht verständlich ankündigt, sollten die Referent*innen gut gebrieft werden, ihre Inhalte auch leicht verständlich vorzutragen.
- Zielgruppe klären: Für wen mache ich diesen Text oder Vortrag? Wie alt ist mein Publikum? Spreche ich mit Personen aus Institutionen? Mit Freischaffenden? Welches Vorwissen bringen sie mit? Welche Inhalte sind für meine Zielgruppe relevant? Welche Infos braucht meine Zielgruppe, um mein Thema zu verstehen? Wie stelle ich den Inhalt für die Zielgruppe am besten dar? (z.B. visuelles Material? In welcher Sprache?)
- Konkretes, umsetzbares Ziel setzen: Welche Fragen oder Themen möchte und kann ich bearbeiten? Was sind meine Kernaussagen, mit denen ich mein Ziel erreiche? Tipp: Kernaussagen mit Dass-Aussagen formulieren (nach der Journalistin, Schreib- und Medientrainerin Beate Krol): Meine Zuhörenden sollen erfahren, dass…
Beim Schreiben
- „Roten Faden“ herstellen: Schafft eine Verbindung, die euren Text von Anfang bis zum Ende „zusammenhält“. Häufig wird dafür die klassische Einleitung-Hauptteil-Schluss-Struktur genutzt. Dabei stellt ihr zu Beginn eure Fragen vor (Einleitung). Dann setzt ihr euch mit Argumenten, Beispielen usw. mit diesen Fragen auseinander (Hauptteil). Am Ende fasst ihr die Ausgangsfrage und die Antwort darauf kurz zusammen (Schluss). Achtet darauf, dass ihr euch am Ende wirklich auf eure anfangs vorgestellten Fragen bezieht. Euer Publikum sollte am Ende mit einem oder mehreren neuen Gedanken herausgehen. Wiederholt durch den Text hindurch die wichtigsten Informationen (vor allem beim Sprechen!).
- Struktur schaffen: Teilt euren Inhalt in sinnvolle Abschnitte ein. Nutzt dabei Überschriften, Absätze und Aufzählungen. Beim Sprechen könnt ihr zum Beispiel Sprechpausen nutzen oder ankündigen, wenn ein neues Thema kommt. Ihr könnt Fragen (an euch selbst, an das Thema oder ans Publikum) stellen, um neue Aspekte hervorzuheben.
- Außen-Perspektive einholen: Zeigt einer anderen Person, die mit dem Thema nichts zu tun hat, euren Text. Welche Stellen sind noch unklar?
Beim Teilen
- Raum für Fragen schaffen: Gibt es die Möglichkeit für Rückfragen, z.B. nach einem Vortrag? Gibt es eine Kontaktperson für Fragen?
- Zuhören, Zusehen und Lesen vereinfachen: Achtet auf eine möglichst deutliche Aussprache und ein angenehmes Sprechtempo. Besonders lange Wörter, Eigennamen oder Titel von Büchern, Filmen usw. werden oft viel zu schnell ausgesprochen. Unterstützt euren Vortrag mit Körpersprache, also mit Mimik und Gestik. Beim Schreiben achtet darauf, dass die gewählte Schriftart gut lesbar ist (z.B. Schriftgröße, Schriftart, Kontraste, mehr Infos dazu z.B. hier).
Dieser Leitfaden wurde von Diversity Arts Culture und kultur_formen erstellt.