Die Ausschlüsse werden mitgestreamt
Gespräch über Klassismus mit Nenad Čupić
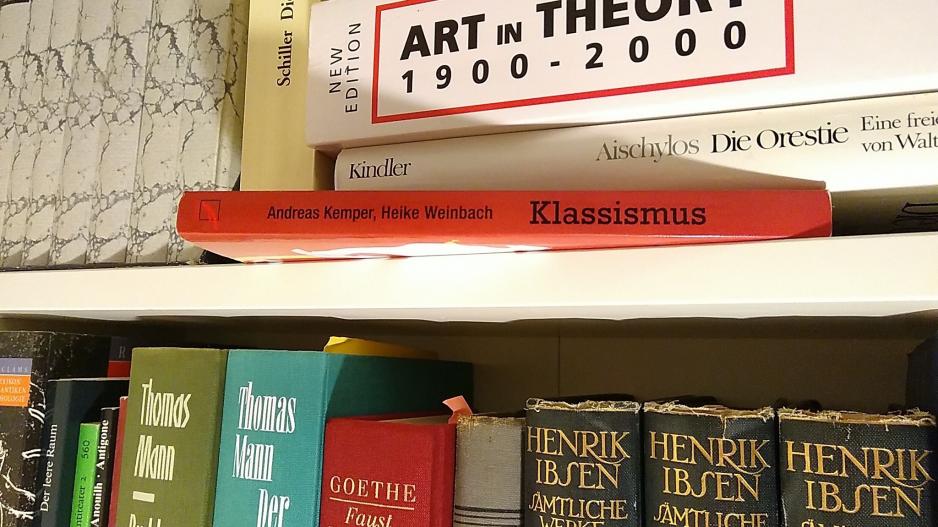
Welches Wissen wird anerkannt?
Nenad Čupić ist Trainer und Berater für Diskriminierungskritik und Diversitätsorientierte Organisationsentwicklung und diskriminierungssensibler Coach. Seine Schwerpunkte sind Klassismuskritik, Männlichkeit, Kolonialismus- und Rassismuskritik sowie Weißsein und Empowerment. Er kann über seine Webseite angefragt werden.
Lisa Scheibner ist Referentin für Sensibilisierung/Antidiskriminierung bei Diversity Arts Culture und freischaffende Schauspielerin.
Klassismus: Diskriminierung aufgrund der sozio-ökonomischen Herkunft
Lisa Scheibner: Der Begriff Klassismus als Diskriminierungsform ist nicht allen vertraut. Was verstehst du darunter?
Nenad Čupić: Klassismus ist Diskriminierung aufgrund der sozio-ökonomischen Herkunft eines Menschen und dessen sozialer Position innerhalb der Gesellschaft. Klassismus meint die Unterdrückung der benachteiligten Klassen, also der Klasse armer Menschen oder der Arbeiter*innenklasse, zum Vorteil der dominanten Klassen, also der herrschenden, der besitzenden Klassen, teilweise auch der (mittleren oder oberen) Mittelklasse.
Man kann verschiedene Ebenen unterscheiden, auf denen Klassismus wirkt. Dazu gehört die Ebene des zwischenmenschlichen Verhaltens, die strukturell-institutionelle Ebene mit ihren etablierten Gesetzen, Praktiken oder politischen Systemen, und die kulturell-ideologische Ebene mit ihren (un)ausgesprochenen Normen. Diese Ebenen bilden dann zusammen die Kultur oder den Diskurs, welcher die Ungleichheit bewertet und die Ungerechtigkeit legitimiert. Diese Kultur wird sowohl durch individuelle Denk- und Verhaltensweisen als auch durch die gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen hervorgebracht und stabilisiert.
Lisa Scheibner: Du hast am Anfang von sozio-ökonomischer Herkunft gesprochen. Was ist damit gemeint?
Nenad Čupić: Zu sozio-ökonomischer Herkunft gehört das Einkommen, das ich habe, und das Vermögen, auf das ich oder Menschen in meinem engeren Umkreis zugreifen können. Zur Herkunft gehören auch die Wohn- und Lebensverhältnisse – ob ich in einer kleinen oder großen Wohnung wohne, ob die Wohnung mir gehört oder eine Mietwohnung ist, ob ich in einem Haus wohne und so weiter. Zur Herkunft gehört auch die Bildung, die ich im Laufe meines Lebens erworben habe: Auf welcher Schule war ich? Welche Möglichkeit hatte ich, meine Freizeit zu gestalten? Mit welchen Menschen hatte ich zu tun? Es gehört aber auch dazu, was Menschen anziehen, in welche Restaurants sie gehen (können), welche Bücher sie gelesen haben, ob sie in Kultureinrichtungen gehen konnten.
Sind wir nicht alle ein bisschen prekär?
Lisa Scheibner: Im Kulturbetrieb arbeiten viele Menschen unter eher schlechten Arbeitsbedingungen: Sie haben befristete Verträge, müssen immer wieder Projektanträge stellen, Stellen sind schlecht bezahlt ... Deswegen haben viele Kulturschaffende das Gefühl, dass sie sehr prekär leben. Eigene Privilegien fallen uns häufig nicht auf und da viele Kulturschaffende bildungsbürgerliche Biografien haben, verstärkt sich im gemeinsamen Arbeitskontext das Gefühl, dass bestimmte Ausgangsbedingungen selbstverständlich sind. Aber wenn wir genau hinschauen, gibt es große Unterschiede, welche Sicherheiten Menschen haben. Das zeigt sich zum Beispiel in einer Krise wie jetzt. Wer ist tatsächlich von Klassismus betroffen?
Nenad Čupić: Alle Menschen sind von Klassismus betroffen, wenn wir Klassismus als ein System begreifen. Kein Mensch kann außerhalb eines Diskriminierungssystems stehen, sondern ist immer innerhalb dieser Unterdrückungsverhältnisse positioniert. Die einen sind strukturell privilegiert, den anderen wird die Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse erschwert oder ihnen werden durch systematische Aberkennungsprozesse Rechte und Rechtsansprüche verweigert. Ihre Lebensweisen und Wertvorstellungen werden nicht anerkannt oder sogar gesellschaftlich unsichtbar gemacht. Über die feinen Unterschiede im Kulturbetrieb wird viel zu selten gesprochen. [Anmerkung der Redaktion: „Die feinen Unterschiede“ ist ein Buch des Soziologen Pierre Bourdieu, in dem er unter anderem die Verbindung von sozialem Status und Kunstgeschmack untersucht] Es wird häufig so beschrieben, auch teilweise von Teilnehmenden der Workshops, die ich leite, als würde das Arbeiten in prekären Verhältnissen für alle das gleiche bedeuten. Es macht aber einen großen Unterschied, ob und wie stark eine Person ökonomisch abgesichert ist, beispielsweise durch eine bereits angetretene oder bevorstehende Erbschaft, durch Wohneigentum, durch vermögende und/oder einkommensstarke Partner*innen, Familienangehörige und Freund*innen. Wer etwa durch Covid-19 und die daraus folgenden Einschränkungen finanzielle Einbußen erlebt, muss über ein Wissen verfügen, wo und wie Soforthilfe beantragt werden kann und Amtsdeutsch verstehen.
Klassismus kommt selten allein
Lisa Scheibner: Es gibt gesellschaftliche Gruppen, die überproportional oft von ökonomischer Benachteiligung betroffen sind. Wie wirkt Klassismus intersektional in Zusammenhang mit anderen Diskriminierungsdimensionen wie Rassismus und Ableismus?
Nenad Čupić: In Bezug auf Rassismus merke ich in den Workshops, dass es für Schwarze Menschen, Personen of Colour und migrantisierte Menschen teilweise schwierig ist, zu unterscheiden: ist diese Erfahrung eine Rassismus- oder eine Klassismuserfahrung? Ich würde sagen, dadurch, dass aktuell mehr über Rassismus gesprochen wird, ist das Problembewusstsein hier größer als bei Klassismus. Wenn man bei Theatern auf das Ensemble, die Dramaturgie oder die Leitungsebene schaut, ist das nach wie vor eine Landschaft, die von weißen Menschen, meistens Männern, dominiert wird. Die Klassensozialisation sieht man ihnen nicht an. Mein Eindruck ist aber, dass sich in den wichtigen Entscheidungs- und Machtpositionen meist weiße Menschen wiederfinden, die aus der Mittelklasse, der oberen Mittelschicht oder Oberschicht kommen. Und es macht auch einen Unterschied für Künstler*innen, welche Staatsbürgerschaft sie haben, welchen Aufenthaltstitel. Manche Kulturschaffende, die bei mir im Workshop waren, haben gesagt, sie können bestimmte Rassismus- oder Klassismuserfahrungen, die sie im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses erleben, dort nicht ansprechen, weil sie einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben, der wiederum an ihr Beschäftigungsverhältnis und ihr Einkommen gekoppelt ist.
Lisa Scheibner: Auch die (fehlende) Anerkennung von Bildungsabschlüssen spielt eine Rolle oder die Tatsache, dass viele Informationen nur auf Deutsch zugänglich sind.
Für viele Menschen mit Behinderung ist es aufgrund von Zugangsbarrieren schwierig, eine künstlerische Ausbildung zu machen und sich eine eigenständige Karriere aufzubauen. Das Bundesteilhabegesetz regelt für Menschen, die Teilhabeleistungen beziehen (etwa für Assistenz), wie viel sie verdienen und sparen dürfen. Ob sie selbstbestimmt leben und arbeiten können, wie das Gesetz verspricht, entscheidet oft der Kostenfaktor und auch, ob sie überhaupt an die entscheidenden Informationen gelangen und die bürokratischen Vorgänge meistern können. Das Risiko mit dem Existenzminimum leben zu müssen, ist hoch.
Fake it until you make it? Klassismus im Kulturbetrieb
Lisa Scheibner: Es gibt bisher keine Daten zu Klassismus im Kulturbetrieb. Aus allem, was wir beobachten, wissen wir aber, dass der Kulturbetrieb stark bildungsbürgerlich geprägt ist. Damit meine ich: eine bestimmte Art von Wissen, von Habitus oder Auftreten begünstigt Karrieren im Kulturbereich. Fallen dir Beispiele für Situationen ein, in denen klassistische Ausschlüsse passieren?
Nenad Čupić: Es gibt zum einen diese unsichtbaren Codes, also das, was mit Habitus umschrieben ist: Eine bestimmte Sprache zu sprechen ohne Soziolekt oder Dialekt, bestimmte Begriffe zu kennen, sich akademisch auszudrücken, Namen von wichtigen Persönlichkeiten, Autor*innen, Künstler*innen, Musiker*innen zitieren zu können etc.
Lisa Scheibner: Es kann aber auch ein Zeichen von Privilegien sein, wenn man die Regeln, die es gibt, bewusst unterwandern kann. Wer kann mit einer zerrissenen Jeans in die Oper gehen und sich trotzdem dort nicht fremd fühlen? Nur wer die Codes sicher beherrscht, kann sie auch brechen und zu einem Teil der eigenen Selbstdarstellung machen.
Nenad Čupić: Wer kann es sich leisten, Regie oder Schauspiel zu studieren, Fahrtkosten für die Vorsprechen zu zahlen? Bildende Künstler*innen haben oft hohe Materialkosten. Wer nicht mit viel Geld sozialisiert ist, kann nicht so gut Gagen oder Verträge verhandeln, scheut sich davor, ein gewisses Risiko einzugehen, denkt nicht so langfristig. Und auch zum Stichwort Altersarmut: Wer prekär freiberuflich gearbeitet hat, hat keine gute Altersvorsorge.
Lisa Scheibner: Da wird das potenzielle Erbe interessant ...
Wo sind die „feinen Unterschiede“ im Kulturbetrieb, durch die sich Karrieren entscheiden? Es gibt zum Beispiel diese Vorstellung, wer erfolgreich ist, ist einfach talentierter als andere. Bourdieu beschreibt, dass eben dieses Talent durch ganz viele unbewusste Informationen bestimmt ist, mit denen man von Kindheit an sozialisiert wird. Die Person hat später ein „Talent“ oder einen „guten Geschmack“ und weiß, was künstlerisch anspruchsvoll und interessant ist. Der Lernprozess, der dahintersteht, wird aber vergessen. Zu Beginn eines Kunststudiums sind manche schon sehr weit, weil sie zuvor viel Wissen und auch Selbstbewusstsein gesammelt haben. Zu diesem Zeitpunkt über Talent zu entscheiden, ist ziemlich schwierig.
Nenad Čupić: Ich muss gerade daran denken, welche Kunstformen als Hochkultur beziehungsweise Subkultur gelten. Jazz, Hip-Hop, Break Dance, Graffiti, Street Art – das sind alles Kunstformen, die erst nach und nach Einzug halten in staatlich geförderte Kulturinstitutionen. Obwohl Hip-Hop den Alltag von vielen Menschen prägt, wird er noch nicht als vollwertige Kunstform angesehen.
Lisa Scheibner: Oder die Kunstform wird angeeignet, das heißt, Künstler*innen mit großem kulturellem Kapital können dann Erfolg damit haben, während die, die die Kunstform oder kulturelle Praxis ursprünglich geprägt haben, in den Hintergrund gedrängt werden.

Was gilt als künstlerisch wertvoll?
Barrieren werden mit gestreamt
Lisa Scheibner: Derzeit gibt es zahlreiche kostenlose Online-Angebote für Kultur- und Bildungsveranstaltungen. Da fallen Barrieren wie Eintrittsgeld und Anfahrt weg. Sind die Veranstaltung jetzt für jede*n zugänglich?
Nenad Čupić: Diese Online-Angebote können nur von Menschen genutzt werden, die Zugang zu einem Computer und einer schnellen Internetverbindung besitzen und die Angebote in einer ruhigen Umgebung wahrnehmen können. Die Angebote werden auch eher von Menschen genutzt, die die Institution schon vor der Covid-19-Pandemie kannten. Denn wieso sollten sich Menschen plötzlich für eine Institution interessieren, die sich vor Corona nicht für sie interessiert hat, die sie nicht mitgedacht, nicht angesprochen hat? Nur weil etwas online gestreamt wird, heißt das nicht, dass die Ideen und Praxen des Ausschlusses nicht mit gestreamt werden.
Lisa Scheibner: Auch weitere Barrieren bleiben bestehen, wenn Fragen der Zugänglichkeit nicht adressiert werden, etwa durch fehlende Verdolmetschung, Untertitel oder Transkription.
Kulturelles Kapital: Wertvolles Wissen
Lisa Scheibner: Bourdieu hat über die verschiedenen Arten von „Kapital“ geschrieben, die einer Person Handlungsoptionen geben. Was wäre „kulturelles Kapital“, wenn wir an den Kulturbetrieb denken? Was wäre „soziales Kapital“ oder „symbolisches Kapital“?
Nenad Čupić: Bourdieu unterscheidet drei Formen des kulturellen Kapitals. Das „inkorporierte kulturelle Kapital“, wozu bestimmte Fähigkeiten oder Fertigkeiten, letztlich Bildung und ein bestimmtes Wissen gehören, das an den eigenen Körper gebunden ist. Man könnte vereinfacht Habitus dazu sagen. Da fallen mir für den Kulturbetrieb Beispiele ein wie das Wissen, wie ich mich in künstlerischen Räumen zu verhalten habe, wie ich mich bewege, wie ich mich anziehe, wie ich spreche, welche Künstler*innen ich zitiere etc.
Das „objektivierte kulturelle Kapital“ umfasst Kunstobjekte, teure Instrumente, Bücher, Filme, Schallplatten, die ich besitze.
Zum „institutionalisierten kulturellen Kapital“ zählen zum Beispiel Abschlüsse von renommierten Kunsthochschulen, Universitäten oder Akademien. Auch Auszeichnungen gehören dazu, Preise, oder Meister*innenklassen mit Spitzenkünstler*innen, genauso wie die Teilnahme an Residenzprogrammen.
Was das soziale Kapital angeht, würde ich sagen, dass der Kunstbetrieb extrem stark über Netzwerke funktioniert. Kenne ich einflussreiche Künstler*innen, Kurator*innen, Leiter*innen von Kulturinstitutionen, Kulturpolitiker*innen, die mir Zugänge im Kulturbetrieb schaffen und erleichtern können? Wenn ich selbstverständlich von Kunst- und Kulturschaffenden umgeben bin, bekomme ich eine Art kontinuierliches Mentoring. Ich lerne nebenbei, wie ich mich in gewissen Situationen verhalte, was bei einem Vorsprechen passieren kann, was in eine Mappe gehört und so weiter.
Lisa Scheibner: Was ich in Bezug auf das Kulturelle Kapital auch deutlich wahrnehme, ist, dass es einen bestimmten kanonisierten Kulturbegriff gibt, der – wie du vorhin schon in Bezug auf Hip-Hop meintest – vorgibt, was „künstlerisch wertvoll“ ist und was nicht. Es kann sein, dass ich Wissen über bestimmte Musik oder Kunst habe, aber das nicht die „richtige“ Kunst ist. Es gibt einen bestimmten eurozentrischen Kulturbegriff, der als Kapital anerkannt wird.
Nenad Čupić: Dieser Kulturkanon umfasst hauptsächlich weiße, bürgerliche, männliche, heterosexuelle Geschichten. Die Lebensweisen und Werdegänge, die auf der Bühne gezeigt werden, können Wege aufzeigen, die nachgegangen werden können. Ich glaube, die Frage der Identifikation ist sehr zentral.
Lisa Scheibner: Ja, denn warum soll man sich für eine Kunstform begeistern, wenn man sich selbst da nicht sieht oder immer nur stereotyp verhandelt? Der Kanon bräuchte dringend ein Update.
Empowerment gegen Klassismus: Gemeinsam stärker werden
Lisa Scheibner: Wenn (angehende) Kulturschaffende feststellen, dass sie aufgrund von Klassismus auf Barrieren stoßen, was können sie unternehmen?
Nenad Čupić: Man kann beispielsweise, sofern man schon für eine Kulturinstitution tätig ist, sich dafür einsetzen, dass eine Antidiskriminierungsklausel in Verträge aufgenommen wird. Ein zweiter Punkt ist, sich weiterzubilden, also zum Beispiel Bücher zu Klassismus zu lesen, um besser zu verstehen, wie er funktioniert. Was ich erlebe und auch immer wieder gespiegelt bekomme, ist, dass es bestärkend ist, von Menschen zu lesen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ein weiterer Punkt wäre, Empowermenttrainings für Menschen mit Klassismuserfahrung zu organisieren und/oder daran teilzunehmen. Austausch ist empowernd, denn diskriminierende Systeme wie Klassismus funktionieren auch darüber, zu vereinzeln und Scheitern zu individualisieren. Daher ist es so wichtig, sich zusammenzuschließen und (temporäre) Gemeinschaften zu gründen, wo eben diese Erfahrungen besprochen werden können.
Die eigenen Strukturen befragen
Lisa Scheibner: Wie können Kulturschaffende, die klassistische Strukturen in ihren Arbeitsumfeld abbauen wollen, damit anfangen?
Nenad Čupić: Sich weiterbilden, eine diskriminierungskritische Leitlinie entwickeln und diese dann veröffentlichen, um die darin formulierten Inhalte nach außen hin überprüfbar zu machen. Das Festival Theaterformen hat das beispielsweise gemacht. Sich diskriminierungskritische Organisationsentwicklung ins Haus holen, um die eigenen Strukturen unter professioneller Anleitung zu reflektieren und im Idealfall zu verändern. Personen mit Klassismus- oder Diskriminierungserfahrung ausdrücklich ermutigen, sich zu bewerben, und sich dann auch bemühen, ein diskriminierungskritisches Arbeitsumfeld zu bieten.
Lisa Scheibner: Eine weitere Möglichkeit ist, soziales Kapital zu teilen, wenn ich die Möglichkeit habe, „Vitamin B“ für jemanden zu sein. Oder jemanden als Mentor*in zu begleiten.
Nenad Čupić: Mentor*innen, Aladin El-Mafalaani nennt das soziale Pat*innen, sind sehr wichtig. Institutionen sollten Praktika besser bezahlen und unbezahlte Arbeit nicht dulden oder zumindest nicht explizit erwarten. Als freies Kollektiv oder freie Gruppe mit wenigen Ressourcen kann man sich alle zwei Wochen oder ein Mal im Monat für ein paar Stunden zusammensetzen und sagen: wir lesen gemeinsam klassismus- oder diskriminierungskritische Texte. Oder wir nutzen diese Treffen, um uns für unsere eigene Sozialisation zu sensibilisieren, vielleicht auch diskriminierungsrelevante Konflikte anzusprechen.
Lisa Scheibner: Ich finde es auch wichtig, sich das eigene Verhalten anzuschauen. Der Vorteil von freier Arbeit ist oft, dass man mehr Flexibilität hat. Dann kann ich mich fragen: Wie ist das, wenn einzelne in der Gruppe nebenbei arbeiten müssen? Was ist, wenn jemand Kinder betreuen, Angehörige oder Freund*innen pflegen muss? Bin ich in der Lage, mit meinen Probenzeiten darauf zu reagieren? Wenn ein*e Kolleg*in eine Krise hat, wie kann ich dabei helfen? Denn Krisen sind die Momente, wo du „hinten runterfällst“, weil du nicht performen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Werden Kulturschaffende, die nicht immer 150 Prozent geben können, trotzdem künstlerisch ernstgenommen? Wenn du nicht ‚performen‘ kannst, kann es sein, dass deine Karriere nicht weitergeht. In diesen Fällen ist das Unterstützungssystem essenziell.
Nenad Čupić: Es ist wichtig, sich zu unterstützen und solidarisch miteinander zu sein. Was ich aber im Kunst- und Kulturbetrieb stattdessen oft erlebe, ist ein extrem großer Konkurrenzkampf.
Es ist auch gut, sich über das Betriebsklima und die Arbeitskultur auszutauschen. Teilweise verpassen Gruppen oder Organisationen Lern- und Entwicklungschancen, weil sie nicht aktiv nach Diskriminierungen bzw. Benachteiligungen fragen. Denn es kann sein, dass Menschen stumm bleiben, die Diskriminierungserfahrungen machen, wenn nicht ausdrücklich Signale gesendet werden, die zeigen: wir wissen, dass wir nicht alle gleich sind und es ist für uns produktiv und notwendig, darüber zu sprechen und dann zu sehen, wie wir mit diesen unterschiedlichen Ressourcen umgehen. Veränderung ist nicht leicht, weder für Einzelpersonen, noch für Organisationen. Gleichzeitig ist das Festhalten noch viel schwieriger, weil sich die Veränderung so oder so einstellt. Ich kann das akzeptieren und selbst mitgestalten oder ich kann auf den nächsten Diskriminierungskonflikt warten, der mich zum Reagieren zwingt. Unter Spannung ist es allerdings schwerer, eine Veränderung in Gang zu bringen.
Ressourcen teilen, Zugänge und Repräsentation schaffen
Lisa Scheibner: Viele Kulturinstitutionen sagen, dass sie sich einen diverseren Nachwuchs wünschen. Gleichzeitig wird erwartet, dass Mitarbeitende bestimmte Ressourcen mitbringen. Was müsste passieren, damit auch junge Menschen, die keine bildungsbürgerliche Sozialisation haben, ihr künstlerisches Talent entdecken, und ihr Interesse, im Kulturbetrieb beruflich aktiv zu sein, verfolgen können?
Nenad Čupić: Das Bewusstsein für Diskriminierung(skritik) müsste innerhalb der künstlerischen Ausbildung gesteigert werden und (Hoch)Schulen müssten ihre eigene Praxis macht- und diskriminierungskritisch hinterfragen. Sie könnten dann sehen, wo genau Nachholbedarf oder Leerstellen bestehen, und sich Unterstützung von Expert*innen holen. Das kann beispielsweise durch eine diskriminierungskritische Beratung oder Diversitätsorientierte Organisationsentwicklung geschehen oder über das Einstellen von Dozent*innen, die Erfahrung mit Rassismuskritik, Klassismuskritik, Sexismuskritik mitbringen und aus einer empowernden und machtkritischen Position heraus agieren können. Die (Hoch-)Schulen können auch Kooperationen mit Initiativen eingehen, die zu Diskriminierung arbeiten.
Es ist wichtig, die Repräsentation zu stärken, das heißt, Menschen auch auf höhere Leitungsebenen zu bringen, die diese Erfahrungen machen bzw. gemacht haben und als Vorbilder fungieren können. Man kann auch mehr kostenlose oder günstige Angebote schaffen. Außerdem können Institutionen sich Gedanken darüber machen, wie sie ihre Ressourcen zugänglich machen können: Raum, Technik, Kamera, Licht, Ton.
Lisa Scheibner: In England haben viele Institutionen eigene Programme zur Nachwuchsförderung oder vergeben Stipendien, bei denen sie in jeder künstlerischen Abteilung eine Person ‚in residence‘ haben, die dort ein Jahr lang ein eigenes Projekt entwickelt und am Ende präsentiert. Es gibt in Deutschland so wenig Aufstiegsmöglichkeiten an Kulturinstitutionen, man könnte daran arbeiten, diese aktiv zu schaffen.
Was wir in unserer Arbeit auch merken: Institutionen müssen sich auf einen längerfristigen Prozess einlassen und offen dafür sein, Praktiken und Strukturen zu verändern.
Nenad Čupić: Die Institutionen, die das nicht machen, verschlafen die Realität. Der große Erfolg der Streaming-Dienste zeigt deutlich, was die Menschen sehen wollen. Die Geschichten, die Identitäten, die in Serien oder Filmen abgebildet werden, sind viel diverser. Bemerkenswert ist auch, was marginalisierte Menschen auf Plattformen wie Facebook, YouTube oder Instagram organisieren, weil es in den staatlich geförderten Kulturinstitutionen fehlt … Wenn die staatlich geförderten Kulturinstitutionen das weiterhin konsequent ausblenden, dann werden sie selbst einen großen Teil dazu beigetragen, nicht mehr relevant zu sein.

